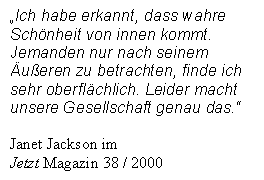zurück
Diskussionsforum
Literatur Kontakt
I. Geschichten vor
der Geschichte - Texte zur Einführung
A.
Insiderwissen: Das richtige und falsche Lacoste
B.
Die Dinge
und deren Merkmale
C.
Die Dinge und deren Bedeutungen
A.
Insiderwissen: Das richtige und falsche Lacoste
„Ich
weiß, dass Du Ahnung hast. Denn, was ich ausdrücke, haben wir gemeinsam
gelernt. Wir sind die Experten. Du kriegst mich dennoch nicht (www.Ein-Philosoph-steckt-in-mir.de
). Du weißt nicht, dass ich ein Geheimnis trage - wenn Du es wüsstest wäre
ich schlimm dran und schuldig, mich zu rechtfertigen (www.ich-bin-ambivalent.de
). Weswegen ich an welchen Orten mich rechtfertigen muss, weiß ich ganz
genau, manchmal in die eine und manchmal in die andere Richtung, das hängt
immer von den anderen und meinen 56 kbpm schnellen Stimmungswechseln ab (www.ich-bin-ein-Star.de,
www.manager-magazin.de, www.taz.de).
Ich
weiß, dass ich immer echt und ich sein will. Daher trage ich mein gefälschtes
T-Shirt zwischen den Blöcken und Zellen, in denen die Abkratzer wohnen; und
denke, dass ich mit meinem Zeichen nicht abgestochen werde (www.GuidoWesterwelle.de)
. Wo anders, ich will zum Film, out of the blue, trage ich mein ungefälschtes
T-Shirt, auf dass ich mich mit den anderen erkennen lassen kann; oben in der
Loge gibt’s die besten Plätze ( www.PC-Shopping.de).
Abbildung
1: Falsch oder echt?:
Lacoste T-Shirt blau / Lacoste Pullover blau , 2000,
Quelle:
eigene Fotos


Lacoste
ist gut. Ich trage es schon seit 10 Jahren. Mal richtig und mal falsch, wie
gesagt, es kommt darauf an.... . Auf das Krokodil ist Verlass, frag mich nicht
weshalb, aber damit hatte ich noch nie Schwierigkeiten. Was ja echt
verwunderlich ist – das andere Zeugs musste ich immer wechseln (mit mehr
Risiko verbunden, bin ein kleiner Schisser, das bitte nicht schreiben!).
So
spar ich Geld (www.Billiger-telefonieren.de),
denn Lacoste ist Qualität (das echte und das gefälschte), das Zeug hält
ewig (www.quasiLand’sEnd.de),
und sowohl die bei Breuninger haben ihre Jobs (www.DresdnerBankDieBeraterbank.de),
wie auch der Typ im Fimse® - Laden seinen Umsatz braucht (www.EU-Importfahrzeuge.de
und www.fabrikverkauf.de ).
Man
muss mit der Zeit gehen: ich unterstütze also heute die Wirtschaft (www.OlafHenkelDugeilerOnkel.at),
kaufe öko- und auch sonst ganz –logisch ein (www.ombudsman.nor
) und wenn’s drauf ankommt schreie ich Solidarnosz® für die Wale dieser
Meere (www.Qualität-aus-deutschen-Landen.de)
und esse beim Japaner meine Suppe nicht (www.NenehCherry.com).
Bei den Grünen® gibt’s dafür übrigens eine Gratis – CD mit Walgesang
drauf (www.greenpeace.de).
Abbildung
2: Echt oder falsch?: Lacoste T-Shirt blau / Lacoste Pullover blau , 2000
Quelle:
eigene Fotos


Guter
Tipp, I know. Unter Verbrauchern sollte man zusammenhalten. Mache würden mich
als clever bezeichnen; ich hab dafür was besseres: rapid eye movement® (www.REM.com
). War nicht meine Idee, was inzwischen leider wohl jeder weiß. Macht nichts,
ich nenne das ganze Remix (www.Cocktails.de
).
Ich
werde jetzt gleich was unternehmen fahren, denn ich habe mein Motto: Life’s
what you make it (www.talktalk.com und www.Die-Neue-C-Klasse.de).
Nur noch vorher was Neues (www.Er-möchte-echt-sein)
anziehen.
Zum
Abschluss nochmals mein Tipp: Lacoste ist echt und richtig sicher (www.Der-EURO-kommt.de
und www.Norbert-Blüm.de ), der
Stoff ist unzerstörbar, da kannst du dich drauf verlassen. Wie gesagt: immer
aufpassen, ob du gerade das richtige oder falsche T-Shirt trägst....kann
ansonsten erst recht echt gefährlich werden.
Und
sowieso: Traue nie einem falschen Freund (www.caro-diario.it).
Das mit Dir muss außer Dir ja keiner wissen (www.Matthias-Rust.de).
Du darfst nie den Respekt vor Dir selbst verlieren (www.Ich-bin-doch-nicht-blöd.de),
sonst verlierst Du die wesentlichen Dinge aus den Augen (www.britney.de,
www.playstation.de, www.lebensversicherung.de,
www.unfallversicherung.de, www.berufsunfähigkeitsversicherung.de,
www.haftpflichtversicherung.de,
www.rentenversicherung.de, www.kritische-aktionäre.de).
In diesem Sinne machen wir uns weiter vor, als ob
nichts gewesen wäre.
Gez.
www.anomy.de
Abbildung
3: Alles echt, alles falsch: Lacoste T-Shirts / Lacoste Pullover, 2000
Quelle:
eigene Fotos & Darstellung

B.
Die Dinge und deren Merkmale
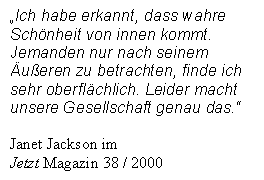
Sein
Aussehen und dessen Umgebung an einer bestimmten ästhetischen Richtung zu
orientieren, unterscheidet den Wissenden vom Barbar.
Der
rohe Tölpel integriert die bei seinem Überfall auf der Handelsstrasse gemachte
Beute nahtlos in seinen persönlichen Fundus. So schmückt er sich in der Folge
mit einem roten Mantel aus Samt und benutzt die Perücke des niedergemetzelten
Grafen nun als Wintermütze. Das erbeutete Material gehört nun ihm, die Dinge
haben ihren Besitzer gewechselt; die Kleider schenken dem Barbaren Wärme und
erfüllen mehr oder weniger zweckmäßig die in sie gesetzten Erwartungen. Der
Barbar wundert sich kurz über die Würde, die er plötzlich in sich fühlt; ihm
ist klar, dass dies an den neuen Kleidern liegen muss. Aber schließlich
entscheidet er, dass diese Kleider – wie im übrigen auch alle anderen –
dazu da sind, vor der Kälte zu schützen; und sowieso findet er, dass durch die
Kleider „das Dasein kein wirklich anderes ist“ (Fichte 1963, S. 43).
Der
Wissende macht seinem Namen alle Ehre: er findet zufällig auf seiner
Kutschfahrt die vom Barbaren übriggelassenen Waren auf der Handelstrasse,
darunter silberne Becher, dicke Bücher und goldene Vasen, die dem Barbar zu
schwer und unnütz erschienen. Er erkennt die edlen Merkmale der Waren und
dekodiert sie als einen Bestand an teuren, adelsständischen Dekadenzen,
die er als aufgeklärter Bildungsbürger aus moralischen Gründen nicht einmal
anfassen darf. Den Kommissar über die beraubte Blutleiche zu benachrichtigen wäre
das allerhöchste, schließlich freut sich der Bürger mit Namen Vorname,
Nachname über jeden Baron von und Graf zu, der
die Gesellschaft nicht mehr mit seiner Biologie umgibt.
Der
Wissende steckt dennoch in der Bredouille: Im eigentlichen findet er die
adeligen Artikel nämlich anmutend, und er denkt, dass entweder a) diese sehr
schön seine städtische Wohnung schmücken könnten oder aber b) durch deren
komplette Veräußerung sein Traum von einem Herrenhaus – er kennt einen
Landsitz eines verstorbenen Adeligen, welches zum Verkauf steht – in greifbare
Nähe rücken könnte. Beide Lösungen a) und b) scheinen unmöglich zu
verwirklichen, denn die bürgerlichen Bekannten würden die herrschaftlichen
Waren als ebensolche entziffern wie auch der Devotionalienkaufmann die
Warenmerkmale als unbürgerlich und suspekt - also als gestohlene Waren -
dekodieren würde.
Der
wissende Bürger steht in einem Konflikt mit seinem Standesbewusstsein und
seiner Moral. Schließlich entscheidet er sich, auf allen (An-) Stand zu pfeifen
und mit den gestohlenen Waren zum Zigeunermarkt zu fahren, in der Hoffnung, dass
dort die gleichgültigen Gauner und Barbaren seine Waren zu schätzen
wissen werden. Denn die Merkmale interessieren dort nicht. Das sich aus dem
Verkauf ergebende Kapital wird sein schlechtes Gewissen letzten Endes
reinwaschen, denn, so weiß er, das Geld ist gleichgültig gegenüber den
Schichten. Er wird es besitzen und vermehren und es werden sich Möglichkeiten
eröffnen, so aufzusteigen, wie er es verdient.
Der
Barbar hat kein Gewissen, er unterliegt keinem Befehl. Er nimmt die Dinge, wie
sie sind. Seine dreckigen Stiefel kombiniert er mit einem roten Samtrock, und er
ist zufrieden über die ihm gegebene Wärme.
Der
Wissende vergleicht sich mit den anderen. Er beobachtet sowohl, wie er auch
begreift, dass er von seinen Klassenangehörigen beobachtet wird. Er ist
standhaft und moralisch; das erkennt jeder an seinen Merkmalen, die er zu
pflegen versteht. Mit verbissenem Einsatz will er in Zukunft den Frust bekämpfen,
denn er sieht ein, dass sich seine Merkmale nie ändern werden.
C.
Die Dinge und deren Bedeutungen
|
|
„Was sehe ich denn
aber außer Hüten und Kleidern, unter denen auch Automaten stecken könnten?
Ich urteile aber, es
sind Menschen.“
(Descartes 1641) |
Beim
Besuch des Kammerkonzerts im kleinen Nebenraum einer städtischen Sport- und
Kulturhalle steht das technische Können des vierköpfigen Orchesters und der
seit Jahrhunderten vorgegebene Aufbau der Musikstücke unter der Beobachtung des
auf die korrekte Form der Darbietung ausgerichteten Publikums. Werden die
Kammermusiker in der Lage sein, die musikalische Grammatik in einer akzeptablen
Weise zu reproduzieren? Sind unter den Musikern gar Talente, die das Niveau
eines Jugend musiziert Adoleszenten erreichen? Werden Geige, Bratsche und
Cello in der richtigen Fasson gestimmt sein, auf dass es die meisterlichen
Kompositionen in würdigem Einklang mit den Erwartungen des kritischen
Auditoriums aufnehmen können?
Der
natürliche Klang der Instrumente, die handwerklich akzeptable Wiedergabe und
die Akustik des Raumes sind die Maßstäbe, an denen sich die Musiker messen
lassen, und die Zuhörer richten werden. Dabei tritt die Erscheinung der
Beteiligten selbst gänzlich in den Hintergrund; in klassischer Zurückhaltung
werden die Protagonisten in schwarzen Kostümen auftreten.
In
der Hoffung, die puren und statischen Merkmale zum wiederholtem Male
reproduziert zu bekommen, ähneln die intellektuellen Leistungen der Zuhörer
eher den mathematischen Gesetzen als kreativen Improvisationen: Ganz und gar
ohne Verstärker zelebrieren sich die Virtuosen durch ihre Sätze und ihre Akte.
Im wallenden Haar der Cellistin spiegelt sich der Dauercheck durch das auf
Merkmale besessene Publikum. Am Ende bleibt dem die Gewissheit, einige Merkmale
in Perfektion und andere in mediokrer Einfältigkeit erlebt zu haben. Nicht
einmal Berge könnten das Wissen des Expertenpublikums um die Gültigkeit der
Merkmale versetzen. Unverstärkt zeigen sich die Dinge, wie sie sind: „Geschenke
einer vorgegebenen göttlichen Ordnung“ (Poschardt 1998, S. 43), die weder
unterstützt noch repräsentiert werden müssen. Britney Spears hätte hier größte
Interpretationsschwierigkeiten.
Die
asiatische Geigering Vanessa Mae ebenso, obwohl deren musikalische Fähigkeiten
auf weniger re-affirmativen Prothesen als bei der Spears beruhen. Das macht aber
alles gar nichts, denn sowohl Spears als auch Mae verdanken ihre spielballhafte
Existenz einem willkürlich interpretierbaren Bedeutungs-kosmos, einem „Phänomen,
das nicht die Spur eines Geheimnisses in sich birgt“ (Gächter 2000, S.
1).
Das
Dekodieren des Publikums beschränkt sich im Pop auf die verstärkten Äußerlichkeiten
und Äußerungen der Superstars: Wenn eine so dünne Stimme wie die von Britney
Spears, wenn ein so krächzendes Gezirpe wie das von Vanessa Mae, durch die
elektrische Verstärkung ihrer Instrumente eine so beeindruckende physische
Gewalt bekommen, dann muss dahinter ein politischer Wille, eine Willensäußerung
stecken, dann muss das ganze Gefiedel und Gedudel für etwas stehen. Aber
wer oder was soll hier repräsentiert werden?
Mae
ist gleichzeitig und nie Furie, Verführerin im Seidenkokon, Kitsch, Asiens kläglicher
Versuch der perfekten Kopie des Westens, klebriger Lollipop und Mozart-Maschine
– alle Zuschreibungen treffen auf sie zu, keine trifft jemals den Kern. Der
Spielraum bleibt offen, „aus Merkmalen werden Zeichen“ (Poschardt
1998, S. 45).
Gänzlich
zur Oberfläche ästhetisiert, geht es hier um die Verkörperung von sich möglichst
widersprechenden Bedeutungen in einem nicht aufzulösenden Guss, dessen
gleichzeitige Entstehung, Verwertung und Verwerfung einem Model gleicht, das
sich in der einstündigen Modenschau möglichst in 25 verschiedene Lebensmodelle
schlüpft.
Im
Gegensatz zu dem Kammerorchester als einer „Kultur überschaubarer
Einheiten“ (Diederichsen 1996b, S. 102) und Merkmalen, wird die
ordnungsbedürftige aber nie zu
ordnende Symbolik der Pop- oder Massenkultur nur dann zum ordnenden Element,
wenn ihr selbst der Platz einer Ordnungsinstanz verliehen wird. Faszination und
Kontrolle verstärken sich im Popkontext zu göttlichen Phänomenen, nur dass im
Unterschied zum bisherigen ewigen Gott 1) die Menschen hier in einem
demokratischen Akt der Befreiung sich ihren Gott selbst gewählt haben und 2)
dieser Superstar ohne Probleme vom einen auf den anderen Tag abgewählt und
ersetzt werden kann. Wenn die Dinge zu Zeichen werden, kann Gott in Rente gehen.
Alles steht zur Diskussion. Diskussionen entsprechen Gesprächen – und aus „Gesprächen
entstehen Märkte“ (Searls / Weinberger 2000, S. 24). „Einmal in
Kommunikation verstrickt, kommt man nie wieder ins Paradies der einfachen Seelen
zurück“ (Luhmann 1987, S. 207). Die Negation von Wissen, die Abwesenheit
von Eliten und Hierarchien, die Ablehnung von klaren Zuschreibungen, die völlige
Auflösung in der Oberfläche: das sind die Funktionen des Pop-Stars. Dessen
innere Werte sind im Zweifelsfall genauso wenig von Interesse wie der Nutzen von
Mode oder die schädlichen Inhaltsstoffe in Coca-Cola. Oder hat schon einmal
jemand nach den wahren Gefühlen und Problemen von Vanessa Mae gefragt?
Die
Kontinuität des Kammerorchesters bietet durch seine Verbindlichkeit keinerlei disruptive
Merkmale. Es handelt sich vielmehr um eine Privatparty der Elite, die ihre
identische Reproduktion feiert. In diesem Milieu gibt es weder Potenzial für Träume
noch für Masken oder neue Märkte. Die Pop-Stars sind dagegen hin- und
hergerissen von der Diskontinuität ihrer eigenen Oberfläche und werden in
ihrer ganzen Unverbindlichkeit zu dem spannungsgeladenen Surrogat für die
Demokratie, zu dem „Abfall für alle“ (Goetz 1999, Titel), welcher
genau die Hoffnungen schürt und genau die Träume darstellt, denen die
Marktwirtschaft mit ihrem Erfindungsreichtum entsprechen muss. Wenn es für alle
möglichen Erfolgsstorys, wenn es für alle erdenklichen Zeichenkombinationen
genau die entsprechenden Waren gibt – und diese auch noch auf irgendwelchen Plätzen
aufeinandertreffen - dann kann man sowohl im Pop als auch im Kapitalismus von
einer vollen Auslastung sprechen.
Abbildung
4: ohne Autor: Liebe, Freiheit und Toleranz, Werbung für Virgin Cola Quelle: GDI Impuls, # 2, 2000, S. 17

Bestehen
letzten Endes alle Waren und Handlungen aus Symbolen und Repräsentationsaktionen,
ästhetisiert sich der Kontrollmechanismus aus Kultur, Pop, Ökonomie, Konsum,
Gemeinschaft und Individuum zur Re-Repräsentation der stilisierten Bereiche,
die sich dann immer wieder checken, neu erfinden, stilisieren, checken, neu
erfinden, stilisieren, etc... . Das System ist erst dann wieder in einer Art
sozialen Ordnung, wenn das Verhältnis unter den Bereichen geklärt ist, und die
Dinge trotzdem florieren, ähnlich einem sich immer drehenden Pferdekarussell,
wo der Abstand zwischen den Teilnehmern aber immer derselbe bleibt.
Abbildung
5: ohne Autor: Liebe, Freiheit und Toleranz, Werbung für Virgin Cola Quelle: GDI Impuls, # 2, 2000, S. 17

zum
Seitenanfang
zurück