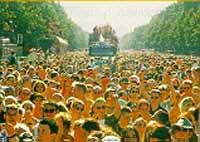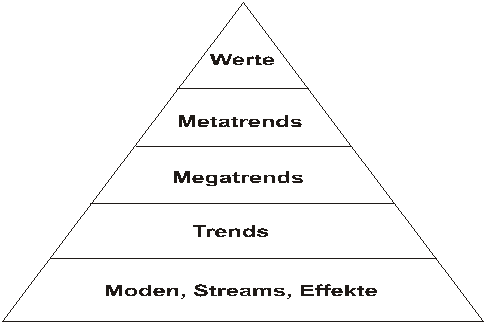zurück
Diskussionsforum
Literatur Kontakt
II. Die
Repräsentation kultureller Zeichen durch kapitalisierende Kompetenzen - Zur Entwicklung von
Trends und Economies
“They
can have any color they want as long as it’s black.”
(Henry Ford)
Sobald
wir die freie Auswahl haben, beginnen wir auf mysteriöse Weise in unserem
Leben prickelnde Chancen zu sehen, die zuvor selbst in unseren kühnsten Träumen
nicht zum Vorschein kommen mochten. Der demokratische Sieg der Auswahl über
den Warendiktator ermöglichte uns auf dem roten Teppich der Differenz zu
flanieren und im Kosmos der Stars und Kometen sogar ein paar Sternschnuppen zu
erhaschen. Und wenn es dazu nicht reichte, gab es immer noch das eine oder
andere Schnäppchen zu machen. Inzwischen nimmt der Vergleich der Dinge so
sehr die Gedanken in Anspruch, dass wir nur noch darin unsere in der
Verfassung verankerte persönliche Freiheit vermuten.
Abbildung
6: Jenny Holzer: From
the Survival Series, 1987
Quelle:
Honnef 1994, S. 183
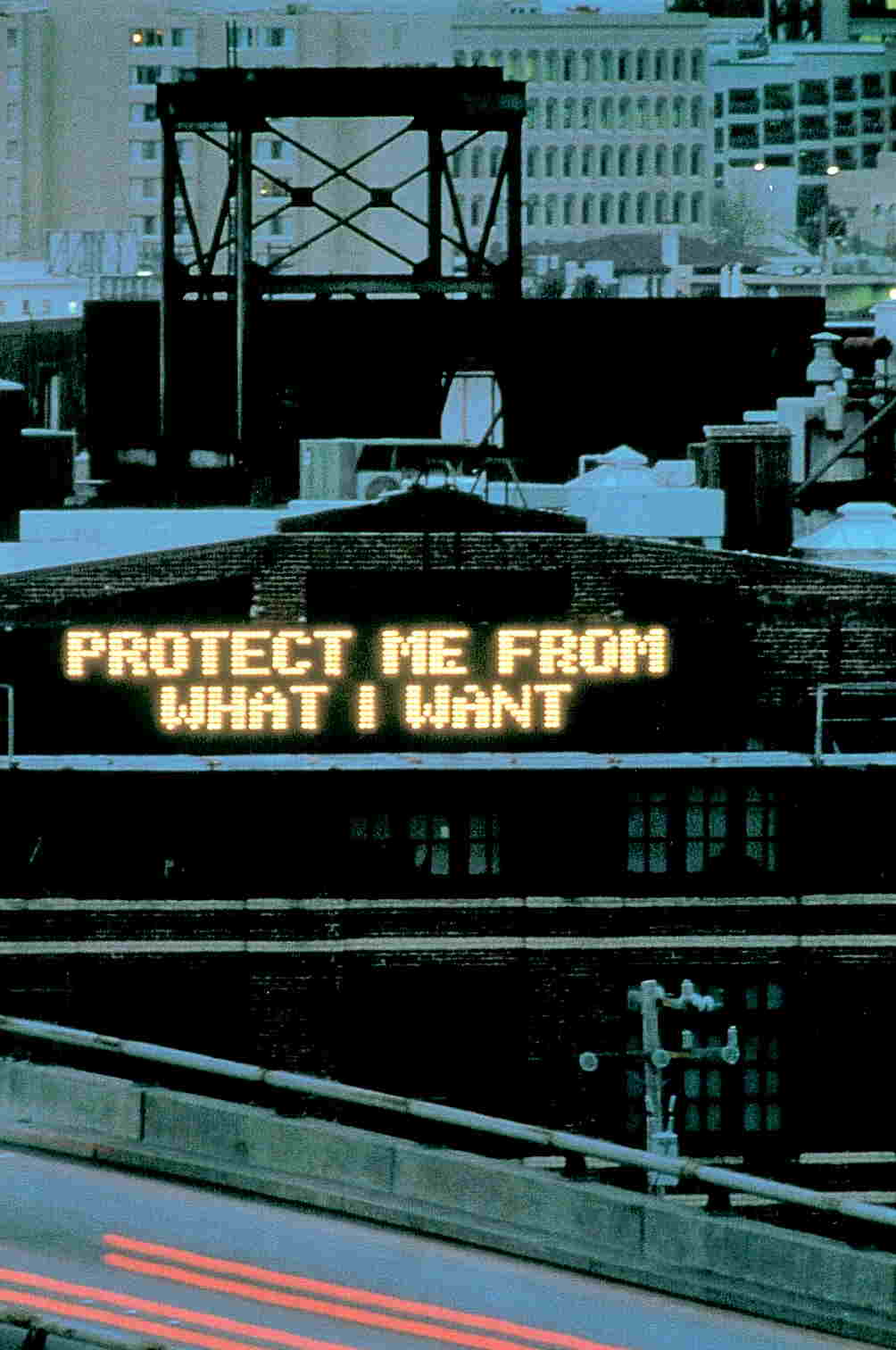
Dem Fundus an verbindenden und verbindlichen Zeichen, quasi dem Genpool
unserer neuen Verfassung, verdanken wir die Tatsache, dass wir in der globalen
Gemeinschaft leben können, obwohl wir physisch allein sind. Jedoch
unterliegen, trotz Globalität und Gleichartigkeit, die Kenntnis und die
Dekodierung der Zeichen hochindividuellen Prozessen – geprägt durch
Geschichte, Erfahrung, Geographie, Geschlecht, etc.. Die Kapitalisierung der
divenhaften Zeichen stößt demnach durch ihre Sperrigkeit auf Probleme, deren
Ergründung jenseits ökonomischer Argumentationen liegen muss.
Dem
Kapitalismus selbst droht nach dem Sieg über seine Konkurrenzsysteme sowie im
Kontext von Illusion und Überfluss die Gefahr der eigenen Überflüssigkeit.
Wenn die Kultur die Entwicklung der Ästhetik bestimmt und das starre
materielle Kapital der Ökonomie im Zusammenspiel mit den individuell
zeitspezifischen Bedürfnissen der Menschen permanent ausgetrickst wird, kommt
der Punkt, an dem der Konsum von materiellem Besitz gegenüber dem schnellen
Ideenverkehr nicht mehr nachkommt. Dem Warenverkehr bleibt dann nur noch die
Rolle einer archaisch anmutenden Transaktion.
Abbildung
7: Pink Floyd: Wish you
were here, LP-Cover, 1975
Quelle:
http://www.amazon.de
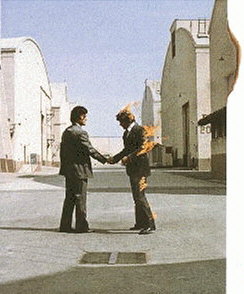 |
Diese Arbeit wird anhand von
Beispielen aufzeigen, dass es sich bei der Marken- und Marktwirtschaft
um einen starren Auswuchs an Selbstgefälligkeit handelt. |
Dem
Überfluss an integren und bürgerlichen Zeichen mit
widerspenstigen und oppositionellen Maßnahmen zu entgegnen, ist
traditionellerweise die Aufgabe der Subkulturen und Avantgarden. Diese vergnügen
sich damit, noch geheime Sphären des Zeichenkosmos zu entdecken und sie mit
den eigenen Gesinnungen zu besetzen.
In
dem permanenten Experimentieren mit Sprache, Musik, Farben, Bildern und Formen
ist für die Gegenkulturen das Scheitern als Resultat dem Erfolg gleichwertig,
ja das Scheitern eröffnet sogar neue Möglichkeiten, mit denen von neuem
experimentiert werden kann. Was dieses Experimentieren angeht, eignet sich
insbesondere die Kunst als immaterielle und somit als roh formulierte und
unkontrollierte Spielwiese für neue anregende subversive Gedanken.
Diese
Arbeit wird die Ressourcen der „coolen“ Zeichen ermitteln und versuchen
eine Anleitung für dauerhaften Ideenvorsprung zu geben.
Bisher
bemühte sich die Ökonomie ausschließlich darum, möglichst erfolgreich die coolen,
also die explizit erfolgreichen Zeichen aus den Subkulturen zu kooptieren. Der
Prozess des Scheiterns jedoch spielt im ökonomischen Universum keine Rolle;
dass sie ihre eigenen Schwächen erkennt und zu erkennen gibt, war der
Marktwirtschaft bisher leider nicht anzumerken. Hierarchien, Automatismen und
der kapitale Erfolgsdruck werden auch in Zukunft den Kapitalismus nicht zum
Scheitern bringen.
Diese
Arbeit wird aufzeigen, dass es sich beim Kapitalismus um eine unreflektiert
agierende Wucherung handelt, die sich durch den Mangel an einer langfristigen
Perspektive, langsam selbst aufzulösen scheint.
Abbildung
8: Ashley Bickerton:
Gequältes Selbstporträt, 1988
Quelle: Honnef 1994, S. 7
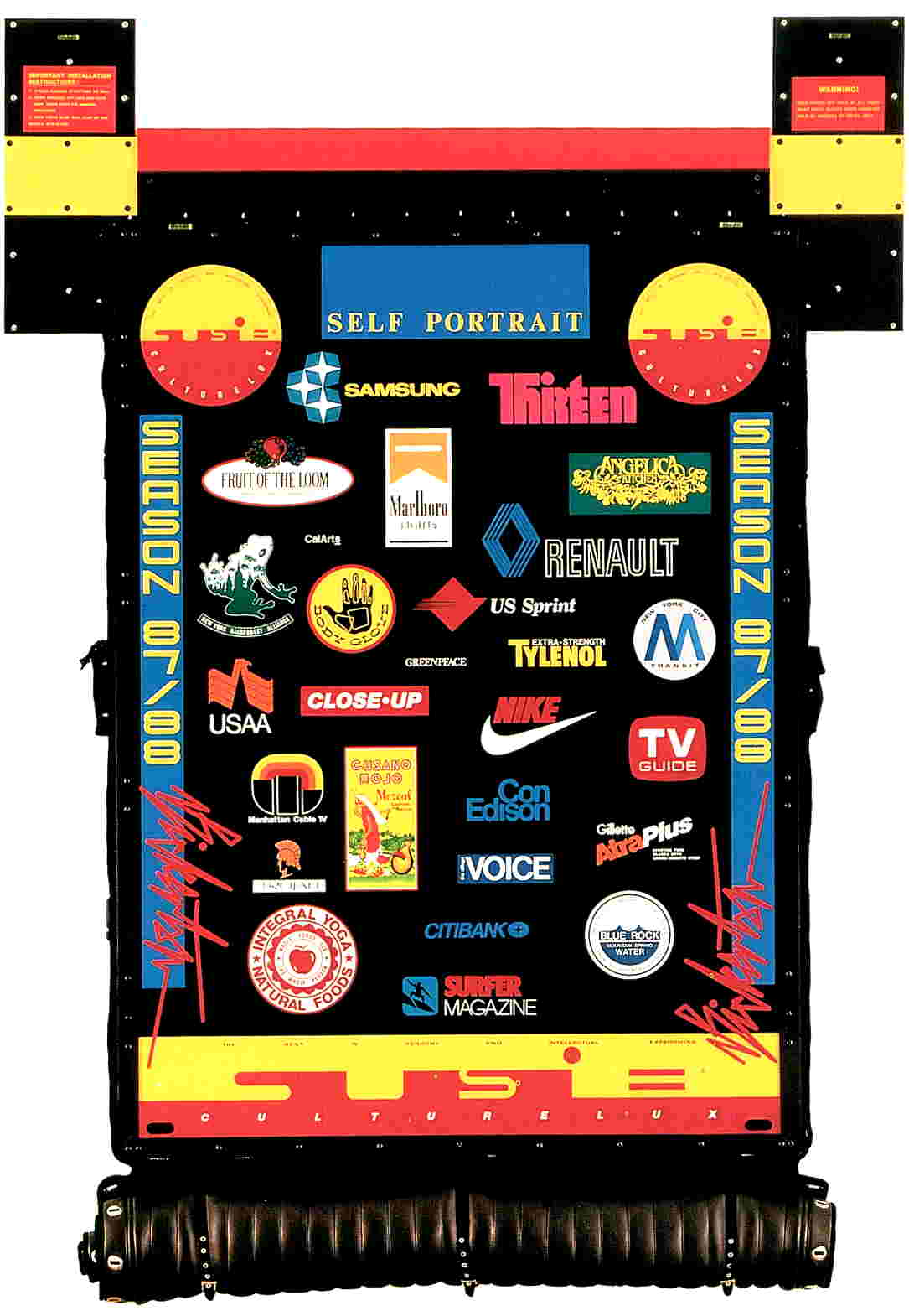
Geplagt
von der eigenen Ideenlosigkeit versucht das Konglomerat aus Wirtschaft,
Werbung, Medien und kooperierenden Individualisten die schon völlig
ausgebrannten Zeichensphären zu verkohlen, wobei das Handeln der ersteren
Bereiche durch deren ökonomische Interessen legitimiert wird. Der von
jeglichen materiellen Nöten losgelöste Nouveau Bourgeois hingegen
versucht in den extremen Ecken der Zeichenwelt seine coole Einzigartigkeit
zu beweisen und bleibt dennoch immer darauf angewiesen, dass die Gemeinschaft
die virtuellen Eskapaden auch zu dekodieren weiß. Tut sie das nicht, fühlt
sich der Dandy schnell wie ein nasser Hund.
Diese
Arbeit wird untersuchen, inwieweit die kulturellen Zeichen einer spekulativen
Ideensammlung gleichen, die leicht und eventuell zufällig - wie ein
Spielkartenkonstrukt - zusammenfallen kann.
Abbildung
9: ohne Autor: Die war
nicht wirklich hübsch. Egal, Hauptsache die Titten hängen raus, Bilder von
der Love-Parade 2000a
Quelle: http://www.freche-jungs.de
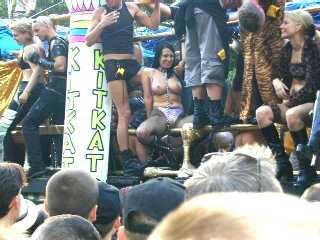
In
der Beschäftigung mit den Bedeutungen bleiben wir Menschen verbunden mit der
imaginären Gemeinschaft; hier spüren wir sogar in den irrealsten Winkeln des
Universums einen Hauch menschlicher Wärme auf. Um
ständig auf der Höhe der Zeit zu
sein – also in der ständigen Kommunikation mit den Zeichen zu stehen -
machen wir selbst vor den makabersten Seiten menschlicher Existenz keinen
Halt.
Abbildung
10: ohne Autor: Jena,
Bilder von der Love-Parade 2000b
Quelle: http://www.freche-jungs.de

Obwohl
wir zu herausgeputzten Selbstbestimmern ästhetisiert sind, muss es uns um
tiefe, rudimentäre Motive gehen, wenn wir uns auf die Hetzjagd nach styles,
tribes & extremities machen. Die Identifizierung mit Grenzüberschreitungen
und radikalisierten Lebensmodellen mit dem Wunsch nach Differenz und
Individualität zu begründen ist die naheliegende Antwort. Dass damit aber
auch der Wunsch nach Gemeinschaft durch das Substitut der permanenten
Selbstkontrolle befriedigt wird, verdeutlicht sich, wenn man weiß, dass die
Form der Gemeinschaft schon immer das wirksamste Kontrollinstrument für die
darin lebenden Menschen bot. Wenn die einzig verbindende Form unserer
Gemeinschaft darin besteht, „auf der Höhe zu sein“ (Kamerun 2000,
S. 11) sowie für die Zeichen der Zeit „stets geschärft zu sein“
(ebd.), und dies die letzte wirkliche Solidaritätsebene darstellt, dann
scheint unser Bedürfnis nach Unterdrückung derzeit die wichtigste Zutat in
unserem kapitalistischen Lebensmenü zu sein. In diesem Zusammenhang wird
klar, dass es beim Wettbewerb um die coolen Zeichen immer auch darum
geht, wer die „strenge Selbstkontrolle“ am besten managt (Holert /
Terkessidis 1996, S. 13).
Abbildung
11: ohne Autor: ohne
Titel, Bilder von der Love-Parade 2000c
Quelle: http://www.freche-jungs.de
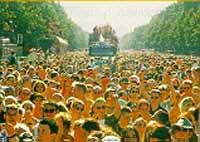
Diese
Arbeit wird analysieren, inwiefern in der marktwirtschaftlichen Freiheits- und
Freizeitgesellschaft individuelle Selbstbestimmung und freiwillige
Selbstkontrolle überlappen.
Nur
wenn wir Individuen wissen, dass die anderen unsere Handlungen richtig
auffassen, werden wir auch richtig handeln (richtig in dem
Sinne, dass wir genau wissen, worum es geht; warum es
- als Beispiel – jüngeren Frauen ausgerechnet in diesem Herbst möglich
ist, die Schlangenleder-Cowboystiefel aus dem Schrank mit den
Karnevalaccessoires herauszukramen und damit ins Büro zu stapfen).
Abbildung
12:o. A.: Sondermodell DM 329,90 Nur noch in Gr. 42 und 44 lieferbar! Quelle:
www.bayernshopping.de

Der
ständige Vergleich belässt die Dinge nicht so wie sie sind, sondern bindet
sie in eine kontinuierliche Bewertung mit den anderen Dingen ein. Nichts ist
so, wie es wirklich ist; die Welt der Zeichen hält uns in Atem. Nur die
Klassiker sind verlässlich.
Diese
Arbeit wird den Gründen nachgehen, warum Trends, Styles und Moden ständigen
ästhetischen Veränderungen ausgesetzt sind. Sie wird versuchen, die
Parallelen zwischen Markenartikeln und Superstars aufzudecken.
Abbildung
13: Madonna: Music,
CD-Cover, 2000
Quelle:
http://www.amazon.de
 |
Der Kapitalismus
materialisiert die Zeichen und verpackt die Träume und Identitäten in
seine Waren. Auf dem Weg zur passenden Identität in Warenform stolpern
wir Konsumenten in Kooperationen mit Einkaufszentren, Stars und
Fernsehsendungen, und werden trotzdem nie richtig verstanden. |
Wer
produziert die Zeichen, die unseren Träumen entsprechen und uns das Gefühl
vermitteln zu einer Gemeinschaft zu gehören? Warum vertrauen wir uns bei
unserem „Lebensprojekt“ (Beck 1997a, S. 11) den Waren an, obwohl
uns der Kapitalismus keine Garantie für die Lebensdauer der Bedeutungen gibt
und wir uns bewusst sind, dass es sich beim Kapitalismus bestimmt um keinen
aufrichtigen Genossen handelt?
Wenn
die Zeichen der Kultur entspringen, kann uns dann vielleicht die authentische
Kunst die identitätsverleihende Ästhetik besorgen, die wir uns so wünschen?
Stellt sich die besagte Authentizität im Zusammenhang mit uns Massen und Märkten
nicht womöglich eine Illusion dar, wo doch jedes Individuum über eine eigene
Komposition an Zeichen verfügt? Können wir uns vielleicht an gänzlich
anderen Maßstäben orientieren? Handelt es sich bei den Styles, Moden und
Zeichen vielleicht sogar um ein großes Universum an Hochstaplereien? Fragen
über Fragen, die jeder hat, aber keiner stellt!
Diese
Arbeit beabsichtigt, Klarheit in die unendlichen Zusammenhänge zwischen Ökonomie,
Kultur, Kunst, Ästhetik, politischer Krise, Individuum und globaler
Gemeinschaft zu bringen, ohne einer der klassischen Untersuchungsmethoden
verhaftet zu bleiben.
Die
Wahrheit liegt im Kontext!
Der
heutige Turbo-Kapitalismus mit seinen Superkonzernen, die wiederum ihre
hypergigantischen Megamarken auf die supergierigen Märkte werfen, auf denen
sich dann die Konsumenten wie die Löwen um die fetten Beutel reißen, steht
vor einem echt starken Problem. Während Großkonzerne à la
DaimlerChrysler mittlerweile die Schwierigkeiten einer globalen Marktbegattung
spüren, und dies inzwischen - zurecht - auf die kulturellen Unterschiede der
verschiedenen Kontinente geschoben wird, stecken selbst regional agierende
Unternehmen mit ihren global präsenten Marken im Dilemma.
Insbesondere
im Konsumgüterbereich, der traditionell stark auf die Imagetransfers der
Jugend und der Szenen angewiesen ist, haben die ehemals coolen Marken wie
Coca-Cola, Nike, Benetton, adidas oder Levis ein Problem mit ihrer Glaubwürdigkeit.
Und zwar geht es hier nicht um ein Problem mit Produktqualität oder ökologischer
Verträglichkeit. Vielmehr steht das Marketing dieser Marken bei den
Konsumenten – vor allem bei den wachsamen Jugendlichen – im Verdacht,
Images nur vorzutäuschen und nicht wirklich so zu sein, wie in der Werbung
propagiert.
Mit
den Worten dieses Aufsatzes formuliert heißt dies: die Zeichen der Markenwelt
sind nicht mehr die coolen Zeichen, weil sie von den viel
aufgeweckteren Individuen, Szenen und Kulturen als verstaubt, falsch und
kommerziell angesehen werden. Die Vorstellungen von den einzelnen Marken, die
mit der eigenen Existenz in Verbindung gebracht werden sollen, stellen sich in
viel komplizierterer und kritischerer Natur dar, wie das die Markenmacher
gerne sehen würden. Konsumenten kennen heute ganz genau den Kosmos der
Zeichen und Bedeutungen und wissen zu unterscheiden, ob ein Produkt heute für
sie akzeptabel ist oder nicht.
Je
größer dabei eine Marke wird, desto kritischer wird ihre Gültigkeit für
die hochindividuellen Lebensvorstellungen gesehen: Warum sollte ich eine
Marke gut finden, die ihre Produkte von Kindern in Asien herstellen lässt,
die überall zu haben ist (sogar in Supermärkten), die von den Lehrern
getragen wird und für die inzwischen jeder dritte Fußball-Bundesligaverein
Werbung macht?
Das
Problem ist dabei vor allem, dass sich die Marken genau mit den (falschen)
Zeichen rühmen, von denen sie in Wirklichkeit
um Generationen entfernt sind. Hingegen wird von den Konsumenten als
ehrlich angesehen, wer die Produkte den Spezialisten vorbehält, wer kritisch
mit seinen Produkten umgeht, wer auch die Leistungen anderer respektiert, und
vor allem wer nicht ständig immer nur mit sich selbst spricht. Marken von
Konzernen, die sich selbst am größten finden, geraten heute vor allem beim jüngeren
Publikum in tiefe Missgunst.
Unternehmen
machen den Fehler, sich selbst für die größten Experten im Bereich ihrer
Produkte zu sehen, während die Kommentare von Konsumenten zum Teil geplant
verheimlicht werden (wie etwa im Falle Mitsubishi). Dabei sind durch
technische Innovationen, v. a. durch das Internet, die Konsumenten meist
besser über die Produkte informiert, als die Hersteller selbst. Während der
Konsument nämlich mit den Konkurrenzprodukten vergleicht (oder z.B. durch
Preis-Broker-Suchmaschinen finden lässt), hat das Unternehmen oft keinen
blassen Schimmer von den Vorzügen anderer Marken, oder gibt dies zumindest
nicht zu.
In
diesem Zusammenhang wird es für die Ökonomie immer wichtiger, sich auf die
kritische Auseinandersetzung mit ihren eigenen Aussagen einzulassen, um möglichst
objektiv von außen analysieren zu können, worin das authentische Potenzial
ihrer Marken besteht. Es geht heute darum, die eigene Position als kommerziell
agierendes Unternehmen nicht nur zu reflektieren, sondern diesen Umstand a)
nicht zu leugnen und b) offen zu thematisieren.
2.
Die Akteure
Der
Kapitalismus hat sich jahrzehntelang nicht um die kulturwissenschaftlichen
Analysen gekümmert. Noch immer wandeln viele seiner Teilnehmer planlos im
Irrlicht der ökonomischen Denke und sehen die Wirtschaft als den sozialen
Bereich, dem sich alle anderen Felder des Lebens unterordnen müssen: Die
Wirtschaft verändert sich ständig, sie ist global ausgerichtet, da muss
mitgezogen werden, während die anderen Bereiche starr sind, monetär nicht
einsatzfähig, also müssen wir uns einigen auf die noch flexiblere
Wirtschaft.
Dabei
vergessen sie, dass es sich bei der Ökonomie wohl um den einfältigsten und
starrsten aller sozialen Bereiche handelt: Während sich die Kultur ihre
eigenen „Zeichen der Zeit“ (Priddat 2000, S. 201) setzt und in
einem permanenten Akt der Umdeutung diese Zeichen neu besetzt werden, hätte
es die Ökonomie am liebsten, wenn alle anderen Bereiche einfach ihre Beiträge
zu den Zeichen (à la Wir sind die Größten, also kauf uns) ohne zu
mucken übernähmen und so die Warenwelt den Träumen der Manager (sprich
leere Lager, leere Regale, etc.) entspräche.
|
|
„Märkte
sind Gespräche.
Unternehmen
müssen einsehen, dass ihre Märkte häufig lachen.
Über
sie.“
(o.V.,
in: GDI Impuls 2000, Titel)
|
Dass
ausgerechnet die gesellschaftlichen Bereiche, welche die Warenwelt am
heftigsten kritisieren zu den begehrtesten, weil authentischsten Imageträgern
gehören, müsste der Ökonomie zu denken geben. Oder hat sie ihre soziale
Rolle ganz aufgegeben und versucht nun, wie die schwedischen Tråndscouts Ridderstrale/Nordstrom
fordern, „die letzten Tabus auszubeuten und darin mehr als gut zu sein“
(Ridderstrale/Nordstrom 2000, S. 244)? Sieht man den Kapitalismus als
ultimativen Terror der 1. Welt über die darin Kontrollierten, dann trifft
diese Aussage aus ökonomischer Sicht sicherlich den Punkt. In diesem Fall
beisst sich die Ökonomie jedoch in den eigenen Schwanz: im Unterschied zu
anderen Wissenschaften und Bereichen der sozialen Ordnung ist sie
notwendigerweise auf den Umgang mit den Menschen und deren Bedürfnissen
angewiesen. Wenn die geschlossene Wirtschaftsgesellschaft die Zeichen der Zeit
nicht erkennt und deren Produkte durch das Wunschgeflecht der Menschen fallen,
entsprechen die Botschaften der Megamarken einer Antikonversation.
Wirtschaftsunternehmen stehen im Gegensatz zu Instituten für Nuklearphysik in
der Mitte des Marktplatzes, wo sie so lebensnah wie möglich präsent sein müssen.
„Der Konsument will von Business nichts wissen“ (Searls /
Weinberger 2000, S. 25).
Es
geht vielmehr, und immer wieder, um Authentizität. In den PR-Abteilungen großer
Konzerne jedoch geht es darum, positive Medienberichte mit Tonnen voll
Selbstanpreisungen möglichst geschickt zu platzieren, Kampagnen möglichst
zielgenau abzuschießen, die Zielmärkte zu bombardieren und Strategien
anzupeilen. PR-Typen und Marketingabteilungen gelten so inzwischen „als
die Gebrauchtwagenhändler der Unternehmenswelt: Man kann ihnen nicht ohne
aktivierten „Bullshit“-Filter zuhören“ (Searls / Weinberger 2000,
S. 26).
In
diesem Zusammenhang bleibt den Unternehmen die Möglichkeit sich in möglichst
effizienter und flexibler Weise in den Zeichenfundus der Kreativen und der
Kulturen einzukaufen. Dieses Konzept aber in eine derartige Dynamik
umzusetzen, wie es nötig wäre, um dem Realen und Authentischen
in all seiner Wucht zu entsprechen, gestaltet sich als unmöglich. Da können
Konsumenten besser auf die Warenhaftigkeit der Zeichen verzichten und sich
stattdessen selbst in den coolen Zeichenfundus stürzen. Halbherzige
Marketingaktionen, wie z. B. allen Produkten das Adjektiv NEU zu
verpassen oder mit dem Kürzel REAL zu versehen, oder das vermeintlich
hässliche der Gesellschaft abzubilden, bieten den Konsumenten jedoch keine
Glaubwürdigkeit. Damit beweißt die Ökonomie mal wieder allen nur, wie sie
den Dialog unter Gleichen überhaupt nicht versteht, und wie sie das Konzept
der Authentizität, wie oben erwähnt, ad absurdum führt, denn, so stellt der
Fotograf Christian Boros fest, ist „man nicht dann ehrlich, wenn man
Ehrlichkeit imitiert, sondern wenn man aufhört zu lügen“ (Wippermann
2000, S. 14).
Dabei
gleicht der Kapitalismus in seiner Struktur und in seiner Art Werte zu
schaffen, immer mehr der Rolle eines Künstlers und Ideenerfinders. Ob ihm
dieser Umstand selbst bewusst ist oder nicht, spielt keine Rolle; der
Kapitalismus befindet sich in der Tat mitten in der Welt der Zeichen, geht es
ihm doch immer stärker um die „Rechte an Marke, Konstruktion, Design und
Know-how, an Optionen, Dienstleistungen und Erfindungen“ (Zielcke 2000b,
S. 17), und immer weniger um den Besitz von Betriebsgebäuden,
Fertigungsanlagen oder hohem Personalbestand. So steht der Kapitalismus nun
vor der Tatsache, dass nicht er die Kultur und die Konsumenten modelliert,
sondern im Gegenteil er selbst von den kulturellen Symbolen und Entwicklungen
umgeformt wird. „Das Eigentum an der ideellen Substanz dirigiert das
Eigentum an der materiellen Substanz“ (Zielcke 2000b, S. 17).
Ist
man zu dieser Erkenntnis gekommen, stellt sich wiederum die Frage, ob die
Frage das Eigentums an der ideellen Substanz, die in Form von
Gestaltung und Ästhetik durch alle sozialen Bereiche schwebt, nicht eine
antiquierte, in der Warenwelt verhaftete Vorstellung bildet. Wem gehören die
kulturellen Zeichen?
Steht
nicht mehr der Besitz des Materiellen im Vordergrund konsumistischer Aktionen,
sondern die Akquisition möglichst gut gestalteter Codes, die sich im
Zusammenspiel mit der schon vorhandenen individuellen Zeichenkomposition
subversiv ergänzen, dann wird deutlich, dass in einem Remix des Realen alle
Konsumenten zu ihren eigenen Zeichensprechern werden. Die Unternehmen müssen
erkennen, dass ihre Ideen, so gut diese auch sein mögen, der Umkodierung
unterliegen. Die Zeichen sind nicht in den Griff zu bekommen, genau das hat
aber die Ökonomie bisher versucht. Im Gegenteil erfordert die Paradoxie der
Zeichen eine permanente Beschäftigung mit ihnen: die Zeichen stehen im
Mittelpunkt des Konsumenteninteresses, weil sie auf der einen Seite Identitäten
und Verlässlichkeiten vermitteln, auf der anderen Seite ändern sich die
Konnotationen ständig, weil jeder in quasi künstlerischen Aktionen den Thrill
der eigenen Andersartigkeit darstellen möchte. Wodurch dann die Identität
wieder auf wackeligen Beinen steht, und die Suche nach dem wahren Ich
von vorne beginnt.
Im
Endeffekt bleibt der Ökonomie die Erkenntnis, dass die Zeichen allen und
keinem gehören, und sie sich durch deren Unklarheit und Unverbindlichkeit mit
Missverständnissen, auf jeden Fall aber mit Prozessen der Interpretation und
der Kommunikation auseinandersetzen muss. Indem unklar und offen bleibt, wer
welche Zeichen zu welcher Zeit liest, wird offensichtlich, dass die Annahme,
bei Individuen oder der Kultur handele es sich um invariante Werte- und
Einstellungssysteme, verworfen werden muss. Und wieder ist es die Kultur,
welche die Differenzen in den individuellen und gruppalen Einstellungen zum
Vorschein bringt.
Für
die Ökonomie stellt sich nun die Frage, wer die Zeichen eigentlich
produziert, die im Kapitalismus ohne Systemfeind ja allein von den Individuen
gelesen und verstanden werden müssen: der Kapitalismus selbst, die Kultur,
die Erfahrungen der Menschen (Gott kommt nicht mehr in Frage)? Die Antwort
liegt wohl in der gesamten Bandbreite, welche auf der einen Seite beginnt mit
den globalen Werten und über die Stationen Nation, Gesellschaft, Gemeinde bis
zu den hochindividuellen Erfahrungen reicht. Das Spektrum und dessen Kontext
setzen die Zeichen in der permanenten Kommunikation untereinander (ein
Prozess, der also wiederum am besten mit dem Begriff der Kultur umschrieben
werden kann).
Im
Vergleich zur Ökonomie hat es die Kultur, im Sinne dieses Aufsatzes die
Kulturproduktion, beim Diskurs um die Symbole und Bedeutungen verhältnismäßig
einfach. Zieht man das reine Aktionsfeld der Kulturproduktion in Betracht, und
lässt zunächst einmal die kommerziellen und pop-kompatiblen Ansprüche außen
vor, geht es der Kultur ausschließlich darum, eine möglichst kritische und
kreative Gegenkonstruktion zum Realen zu etablieren. Kultur ist das, was der
Mensch in Kommunikation mit der Gemeinschaft und den äußeren Umständen
erschafft. Indem sie das Reale deformiert und so eine andere Beschaffenheit
der Wirklichkeit suggeriert, ist das Treiben der Kultur immer eingebunden in
einen Akt der Willensäußerung. Kultur ist nur möglich, wenn Menschen eine
Aussage mit ihrem Tun kombinieren. Der so erschaffene Remix der Dinge
definiert sich durch Bedeutungen, Symbole und kulturelle Zeichen; erst durch
deren Beimischung verbleibt das Abbild nicht nur ein Spiegelbild, sondern
kreiert ein neues, ein eigenes Bild. Kultur produziert also die Zeichen, und
da die Kultur – wie auch die Ökonomie oder die Politik – aus Menschen
besteht, sind die Menschen verantwortlich für die Produktion der Zeichen.
Ohne das Individuum und ohne die Form der Gemeinschaft / des Stammes wären
die Zeichen wertlos. Der Erfolg aller Dinge würde sich nach den zu den
Menschen gehörenden Grundbedürfnissen richten. Ohne die Kultur wären die
Menschen Barbaren (siehe Kapitel III A), alle Dinge entsprächen einem
existentiellen Nutzen, die Kapitalisierung der Zeichen wäre nie ein Thema
geworden.
Nun
kann die Kultur befreit auftrumpfen, denn sie steht im Gegensatz zum
Kapitalismus nicht im Verdacht, als unecht oder menschenverachtend angesehen
zu werden. Sie ist ein Teil im System der Produktion von Zeichen, unterliegt
aber nicht der bedrückenden Aufgabe, diese Zeichen auch verwerten zu müssen.
Und wenn sie das doch tut, entsteht dabei wieder Kultur, wodurch die Kultur
ungefährlich und sympathisch bleibt. Dass alle Beteiligten, also Individuum,
Politik, Gemeinschaft, Kultur und Ökonomie, immer im eigenen Interesse die
Zeichen verwerten, umkodieren, damit spielen, sie verwerfen, etc., bleibt also
solange ungefährlich und korrekt, wie sie die anderen Bereiche respektieren
und als gleichwertig akzeptieren.
Man könnte
aber auch den Spieß umdrehen und behaupten, alle Bereiche im System der
Zeichen und Gefühle bedienen sich immer des kapitalistischen Prinzips, geht
es doch allen Beteiligten immer nur um die eigene Bereicherung und
Selbstverherrlichung. Sogar die sich als Rettungsanker für die elitären
Insider formierenden Sub- oder Gegenkulturen unterscheiden sich in dieser
Hinsicht nicht vom vielgescholtenen Mainstream. Prinzipiell steht für alle
Beteiligten der Kampf um die coolen Zeichen im Mittelpunkt des Aktionsfeldes,
nur mit dem Unterschied, dass sich Subkulturen zeitlich und intellektuell mehr
damit beschäftigen und sie so zumeist höhere Trefferquoten beim Umkodieren
der Zuschreibungen verzeichnen können. Fest steht zum einen, dass bei der Produktion der
Zeichen zumeist die Ökonomie durch deren eingebildete Fokussierung auf monetäre
und materielle Felder gehemmt scheint (es geht in Unternehmen mehr um das
Wiederholen bereits bestehender erfolgsversprechender Tätigkeiten, und
weniger um das Umändern der bekannten Aktionen, was zuviel kosten würde),
und klar ist zum anderen, dass die Erzeugung der Zeichen durch die anderen
Disziplinen zwar stärker und vielschichtiger ausfällt, aber die Bedeutung
des eigenen Schaffens in den seltensten Fällen ge- und erklärt werden kann.
Dies ist auch nicht notwendig, denn auch alleinige Erfahrung reicht zur
Umgestaltung aus (z.B. wissen Künstler oft gar nicht was sie tun; fragt man
sie, warum dies oder jenes auf die eine Weise und nicht anders gestaltet
wurde, bekommt man als Antwort evtl. nichts als fragende Stirnfalten,
Aggression, Schüchternheit, uns anderes ...).
So stellt sich heraus, dass
nicht der schöpferischen Tätigkeit der Zeichenproduktion selbst, sondern der
Fähigkeit, diese Zeichen zu entziffern und zu verwerten, die eigentliche Schlüsselrolle
bei der Verteilung der Werte und Bedeutungen zukommt. Erst durch das Wissen um
die Bedeutung der Zeichen kann dem Physischen und dem Symbolischen zu einer
Liaison verholfen werden, was eine neue Aussage generiert und als politisches
Statement Gültigkeit haben kann. Nur wenn wir wissen was wir tun, haben
wir die Chance genau das zu schaffen, was wir schaffen wollen.
Diese Binsenweisheit aus
einem x-beliebigen BWL-for-beginners-Lehrbuch trifft in unserem Zusammenhang
genau den Punkt: Die Ökonomie hat es sich bisher im Unterschied zu Big
Brother nicht erlaubt, beliebige Zeichen zu lancieren, wäre sie doch
ansonsten in die Gefahr gelaufen, den Ruf ihrer Marken zu gefährden.
Vielleicht sollte sie aber genau das in Zukunft tun.
Schließlich kann das Format Big
Brother zurecht von sich behaupten, den Nerv, also die sicherlich
massentauglichsten coolen Zeichen des Jahres 2000 produziert zu haben, und das
aufgrund eines Aktes der Anarchie. Denn Big Brother hat genau das
gemacht, was sämtliche Subkulturen und Intellektuellen vorher nicht
fertiggebracht haben, nämlich barbarenhaft auf die Bedeutung der Zeichen und
Werte zu pfeifen, und sich nicht darum zu kümmern, wie die eigenen Zeichen außen
aufgefasst werden würden. Wird hier also implizit ein Zuviel an Emanzipation
beklagt? Definiert sich die neue brüderliche Bürgerlichkeit über
ihren Wunsch nach einer „Eindämmung von übertriebenen Individualitätsansprüchen“
(Terkessidis 1999, S. 1)? Wird die Beschäftigung mit den unsicheren coolen
Zeichen langsam zu aufwendig oder zu hirnanstrengend? Besteht die Solidarität
und das warme Gefühl in der Hose für Big Bürger darin, mal wieder
dazu zu stehen, uncool zu sein?
Für
den Mainstream jedenfalls verkörperte BB die perfekte Authentizität, und
jeder BB identifizierte sich damit. Und zwar paradoxerweise genau deshalb,
weil Big Brother eben gar keine Werte, Zeichen oder Bedeutungen
vermitteln wollte. Vermittelt werden sollte im Gegenteil: NICHTS.
Weswegen auch alle Versuche, das Phänomen zu bändigen und zu erklären,
scheiterten. NICHTS ist dem Spaß sehr nahe, weswegen dann die zweite
Staffel Big Brother allerlei nackte, sich duschende Körper bot, also
eine voraussehbare Re-Produktion dessen, „was in der ersten Staffel noch
roh und ungeplant daherkam“ (Wittich 2000, S. 1). Da avancierte das
uncoole Zeichen zum Merkmal, weil die Beteiligten gar nicht wussten, was sie
taten (vgl. Kapitel III A).
In
der Kultur muss es demnach im Gegensatz zur Ökonomie und zur Politik um mehr
gehen, als um die kalkulierte Produktion und Vereinfachung der Werte und
Symbole. Verlagert sich das ökonomische Feld von der Kapitalisierung der
materiellen Nützlichkeiten zu den emotionalen und ideellen Werten, bleibt der
Kultur einerseits immer noch die Herausforderung, die immer noch materiellen
und ideologischen Missstände zu thematisieren. Andererseits hat es die Ökonomie
bisher nicht geschafft, den Fragestellungen der Konsumenten oder
Nicht-Konsumenten an ihre Produkte mit angemessenen Antworten
entgegenzutreten: während die Marktwirtschaft etwa auf die komplexen Probleme
der Globalisierung mit formelhaften Erklärungen versucht, alle von ihrer
Souveränität zu überzeugen, und damit lediglich überschwängliche bis
falsche Sicherheiten verspricht, gehören Komplexität, Reflektion und
Differenzierung zur Logik künstlerischer Arbeit. Und da die Wahrheit
menschlichen Tuns immer im Kontext und nicht in der Formel liegt, steht die
Kultur mit ihren Aussagen und Zeichen den Bedürfnissen der Menschen nach Um-
und Dekodierung näher als die Marktwirtschaft, die diesen Bereich entweder
gar nicht vorsieht, oder lediglich ein gewisses Budget für Trendscouts zur
Verfügung stellt.
Während
in den letzten beiden Kapiteln einige Ansätze dazu gegeben wurden, auf welche
Arten die kulturellen und ökonomischen Felder versuchen, mit dem Problem der
ästhetischen Entwicklungen und deren Input auf die jeweiligen Aktionsgebiete
beizukommen, bleibt noch ungeklärt ob, und wenn, dann inwiefern politische
und staatliche Instanzen zum Entstehen von Zeichengebilden und Trendkomplexen
beitragen. Vorweg ist eines sicher: im Sinne der Erkenntnis, dass es sich bei
den Bedeutungen und Symbolen und Phänomene handelt, die durch politische
Ereignisse, wie die Französische Revolution und der darauf folgenden bürgerlichen
und kapitalistischen Emanzipation (vgl. Kapitel III A) erst ihre eigene Bedeutung
erlangten, steht politische Entwicklung seitdem auch immer im Kontext von
ökonomischer und kultureller Formation. Zudem wäre es widersprüchlich, wenn
im Zuge der Zeichenbildung und der Trendanalyse als reiner Kontextarbeit
zwischen den einzelnen Disziplinen, die Politik von einer Analyse
ausgeschlossen bliebe.
Im
Gegenteil tragen politische Ereignisse und Tendenzen in offensichtlicherem und
weltweit homogenerem Maße zu ästhetischen Themen bei, je mehr sich die
Politik selbst auf das weltpolitische Terrain begibt. Die Kultur prägt
unmittelbar das Entstehen der Ästhetiken und Antiästhetiken, während sich
die Ökonomie darauf beschränkt, die entstandenen Trends und Moden in monetäre
Werte umzusetzen. Die Politik schafft jedoch für die ganzen Handlungen erst
die Legitimationen. Sie setzt sich dabei nicht aktiv mit den Trends und
Symboliken auseinander, sie präsentiert nur deren Effekte in ihrem Tun
selbst. Wenn jüngere Politiker der großen Parteien inzwischen mit grellen
Haarfarben auftreten können und dies nicht einmal die letzte übriggebliebe
Spalte in der Tageszeitung auszufüllen vermag, beruht dies auf dem Umstand,
dass dieser Ableger irgendeiner ästhetischen Entwicklung schon längst
besteht und nun endgültig zum Mainstream avanciert ist.
Politik
übernimmt daher die ihr ureigentlich zugeteilte Rolle des Absegnens eines
Themas aus der gesellschaftlichen, kulturellen oder ökonomischen Sphäre.
Wenn die politische Instanz im Ernst eingestehen würde, dass gewisse Chancen
realisierbar sind (wie etwa das Fahren von Erdgasfahrzeugen), dann bekäme die
Politik sicherlich auch die Auszeichnung verliehen, selbst Zeichen setzen zu können
und Richtungen zu bestimmen – auch im ästhetischen Sinne. Wenn ein
Bundeskanzler Schröder aber auf der Cebit in Hannover verkündet, das
Internet sei ein wichtiger Bestandteil der Zukunft, dann hat er 1) nur etwas
zu verstehen gegeben, was sowieso bereits jedem bewusst ist und 2) gerade
deshalb die Zukunft zur Gegenwart, und damit zum quasi thematischen
Bestandteil und Ziel seiner Politik gemacht. Schließlich repräsentiert
die Politik nicht nur die Gefühle und Stimmungen des ganzen Volkes;
sie gibt mit ihren Statements zur Kultur auch zugleich bekannt, was von nun an
zum Mainstream, zum bürgerlichen Hausrat, gehören soll. In ihrer Rolle
gleicht damit die Politik einem Boris Becker in der AOL-Werbung, der ebenfalls
andeutet, dass selbst der technisch unbegabte und sprachlich trottelige
Durchschnittsmoloch sich in den nächsten Media-Markt begeben sollte, um dort
den Ausweis seiner Zugehörigkeit zum Mainstream zu erhalten. Jedes andere
Verhalten wäre von da an unwirtlich.
Abbildung
14: Wachsendes Abstraktionsniveau der Trendanalyse
Quelle: Liebl 2000b, S. 60
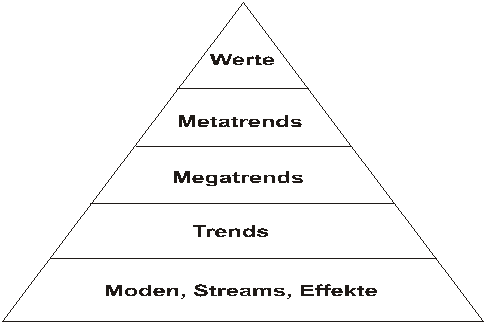
An
Liebls Konzept zum Grad der Abstraktionsdichte abgeglichen (s.o.), kümmert
sich Politik also nicht um sporadische oder szenenspezifische Sachlagen wie
Moden, Trends oder Megatrends, sondern fokussiert ausschließlich die
Meta-Entwicklung, die sie letzten Endes durch Werteverschiebung und
Werteanpassung zum Teil neu mitgestaltet. Ein Beispiel für ein solches Umändern
globaler Werte wäre ein im Sinne der Ökologie erfolgreicher
Klimagipfel, dessen Auswirkungen (auch in rechtlicher, bürokratischer,
globalpolitischer Hinsicht) wiederum die untergeordneten Bereiche Trends,
Moden, etc. in ihrem kontextualen Gefüge beeinflussen würde.
Politik
verkörpert also im Bereich der Zeichen und Entwicklungen tendenziell deren
massenhafte Erscheinungen, die der Umkodierung durch die Klienten (das Volk,
die Ökonomie) nicht mehr bedürfen. Das hindert sie aber nicht daran, in
gesellschaftlichen Bereichen Zeichen zu setzen, welche dann die Richtlinie für
das Treiben der verschiedenen sozialen Bereiche darstellen.
Der
Staat bzw. die Gemeinschaft der entwickelten Staaten zeigt jedoch in
ihrem Betrieb auch Parallelen zum Treiben avancierter ökonomischer und
individueller Bereiche auf. So reagiert die Politik in ähnlicher Ausprägung
auf die Tendenzen in der Wirtschaftswelt (gläserner Markt, klare
Bilanzierungsrichtlinien nach modernen Vorgaben, Deregulierung,
Privatisierung, private Renten) und legitimiert damit zum einen deren
Handlungen und stellt zum anderen wirtschaftliche Erfahrungen als
Vorzeigemodelle für politische Praxen dar. Die Ökonomie zeigt der Politik,
wo es lang geht. Die Politik wird selbst zum Unternehmen und verschiebt
moderne ökonomisch-politische Werte zu allgemeinen Vorstellungen, nach denen
Individuen handeln können.
Selbst
die Lösung hoch-komplexer Aufgaben, die ureigentlich dem Staat zugedacht
sind, wird von der Wirtschaft übernommen.
So ging man, wie Mark Terkessidis herausgefunden hat, Anfang der Neunziger
Jahre davon aus, „der Markt sei der ökonomische Ort ethnisch
indifferenter Vergesellschaftung“ (Leggewie) und „in gewisser Weise
farben- und nationalitätenblind“ (Cohn-Bendit / Schmid, beides in:
Terkessidis 2000, S. 38). „In den letzten Jahren ist es üblich geworden,
den Markt mit Demokratie gleichzusetzen und sein „natürliches“ Walten als
Allheilmittel für gesellschaftliche Probleme zu betrachten“ (ebd.).
So
gleicht sich die Politik der Logik der Vereinfachung der Ökonomie an, auf die
Phänomene der Globalisierung und den dadurch generierten Ängsten,
tendenziell mit reduktionistischen Welterklärungen, die lediglich falsche
Sicherheiten versprechen, zu antworten (vgl. Oswald 2000, S. 4). Der Kreislauf
vervollkommnt sich, wenn auch Individuen, soziale Gemeinschaften sowie
Kulturinstanzen beginnen, ihr Treiben unternehmerisch zu gestalten und vormals
sozial legitimierte Prozesse auf deren monetäre Effizienz hin zu prüfen.
Friktionen zwischen den einzelnen Bereichen verschwinden, was in Zustände mündet,
die von vielen heute als starr und unpolitisch angesehen werden. Dass es das
Phänomen unpolitisch eigentlich gar nicht geben kann, wenn es sich um
soziale Prozesse handelt, wird nicht verstanden.
Aber
wie soll auch die Idee eines Andersseins (was gemeinhin mit der Idee
des Politisch Seins gleichgesetzt wird) verwirklicht werden können,
wenn jeder soziale Bereich selbst sowohl ver- kulturalisiert, ökonomisiert
und legitimiert, also letzen Endes kontrolliert ist, und das Individuum samt
seiner nächsten Umgebung sämtliche Anstrengungen auf Distinktionskämpfe, Style
Wars (Liebl 2000a, S. 131) und ökonomische Identifikationen richtet?
De-
und Umkodierung von Werten macht in diesem Zusammenhang zwar für die Politik,
die Wirtschaft und die Pop-Kultur Sinn, weil so der geschlossene Kreislauf
(Werte, Entwicklungen, Zeichen, Trends, Materialisierung, Repräsentation,
Identifikation, Dekodierung, Umkodierung, neue Werte, neue Entwicklungen, neue
Zeichen, neue Waren, und immer so weiter....) künstlich am Leben gehalten
wird. Spannungsgeladen, im Sinne einer Herstellung von Friktionen zwischen den
im Kreise laufenden Akteuren, ist dies jedoch keineswegs. Die Anstrengungen
der Politik hingegen richten sich auf die Angleichung der Systeme.
Der
Beschäftigung mit den Zeichen und dem Austragen von Repräsentationskämpfen
kommt also die perfekteste Form der Kontrolle zu, die man sich vorstellen
kann. Gilles Deleuze hat die neue Formation der gesellschaftlichen Bereiche
nach ihrem Machttypus und in Abgrenzung zur Disziplinargesellschaft so auch
„Kontrollgesellschaft“ genannt. „In den
Disziplinargesellschaften“, schreibt Deleuze, „hörte man nie auf
anzufangen (von der Schule in die Kaserne, von der Kaserne in die Fabrik), während
man in den Kontrollgesellschaften nie mit etwas fertig wird: Unternehmen,
Weiterbildung, Dienstleistung....“ (Deleuze 1993, S. 254). Während früher
das Unternehmen ein brachialer geheimnisvoller Körper war – ähnlich Kafkas
Schloss – und vor allen Dingen der Ausbeutung der menschlichen Körper
diente, so ist das Unternehmen heute eine „Seele“ (Holert /
Terkessidis 1996, S. 13). Während der Arbeiter seine Einspannung in die
Produktionsabläufe seelisch verneinen konnte, wird heute die volle
Identifikation mit dem Unternehmen erwartet. Während Rio Reiser in den 70er
Jahren aus seiner subkulturellen Sicht davon singt, „diese Woche blau zu
machen, .....oder eben mal auf Stütze zu leben, oder einfach
mal `ne richtige Auszeit (zu) nehmen“ (Reiser 1972), und dieses
Verhalten irgendwann sogar zum guten Ton gehörte, würde diese Abart einer
Ineffizienz heute selbst von den Arbeitenden als höchst uncool angesehen
werden.
„Das
macht niemand. Das will anscheinend auch niemand. Weil man Angst davor hat,
nicht mehr mitzukommen. Das ist dieses unbedingte Auf-der-Höhe-sein, du musst
da geschärft sein. Das scheint ja die Solidarität zu sein: Man fühlt sich
in so einer merkwürdigen Gemeinschaft: „Wir müssen alle zusammen was
anpacken“. Für wen eigentlich? Für einen selber dann doch nicht, denn du
wirst davon selbst nie was haben. Das ist der Wahnsinn, ganz schräge. Und
daraus entsteht natürlich, daß der Wunsch verkümmert, zu sagen: „Hier
stimmt irgendwas nicht. Wir müssen was anderes machen.“ Dieser Wunsch
stirbt völlig ab. Der Wunsch wird als Lüge begriffen“ (Kamerun 2000,
S. 14).
Angeglichen
an die künstlerischen Techniken des Sampling, des Remix, des Cross-Over
und der Bricolage (vgl. Liebl 2000c, S. 135 - 145), die
allesamt die Verfremdung oder Umformung bestehenden kulturellen Materials im
Sinn haben, beweisen sich auch Konsumenten gegenseitig ihre künstlerischen Fähigkeiten
(Skills), indem sie durch Verformung, Kombination von Widersprüchlichem
(z.B. „Hemd von Opa, Gürtel von DKNY, Hose von DKNY, Schuhe Second-Hand“;
o.V. 2000a, S. 15) und kontextualer Umschichtung ihre Machtfunktion im System
der Zeichen und Ästhetiken zur Schau stellen. Bedeutungen, die etwa die
Unternehmen mit dem Positionieren ihrer Marken verdeutlichen wollen, werden so
eigenmächtig umkodiert oder gänzlich verworfen; „neue Werte schaffen
immer neue Märkte“ (Gurk 1996, S. 23), was in den Unternehmen zunächst
unheimlich unsicheres und später souverän angenehmes Erstaunen hervorruft,
oft als hätte man genau dies auch im Sinn gehabt (vgl. Franz Liebls Beispiel
einer Umkodierung durch Konsumenten bei der Mercedes-Benz A-Klasse, Liebl
2000, S.99).
Im
Gegensatz zu den politischen Willensäußerungen der 70er Jahre, die ihre
Missgunst gegenüber gesellschaftlichen Zuständen nach außen trugen, und die
dafür Verantwortlichen anklagten, bleiben die Individuen heute im Kontext von
„Selbst-Organisation“ (Beck 1997b, S. 184) und Ich-Repräsentation
in ihrer gesellschaftlichen Auswirkung zunächst introvertiert. Eine Art
paradoxer Solidarität unter den selbstgenügsamen Individuen stellt sich
dennoch her: „Je individueller man wird (oder richtiger: Je mehr Mittel
man hat, individuell zu werden), desto mehr gehört man auch dazu“ (Terkessidis
1999, S. 24). Die Dekodierung und Konsumtion von kulturellen Zeichen gehört
also zu den Aufgaben von uns hochpolitischen Aktivisten, mit dem Unterschied,
dass Politik heute in extremem Maße Ich - lastig ist, l’état est moi
sozusagen. Die Art und Weise Interessen zu vertreten hat sich verändert, wie
auch die angenehme Nebensache, dass obige Dekodierungs- und
Konsumtions-Aufgaben locker als Hobbys durchgehen.
Wiederum
bleibt das System in sich geschlossen, echte Friktionen stellen sich nicht her
(vgl. Kapitel III D3). Einerseits erhalten „die hilflosen und dünnen
Stimmen (der Individuen) ..... Möglichkeiten der Artikulation“ (Diedrichsen
1996b, S. 96) und revidieren somit die Theorie, dass die „Kulturindustrie“
(Adorno / Horkheimer 1944, S. 149) „dem Verstummen der Menschen, dem
Absterben der Sprache als Ausdruck, der Unfähigkeit, sich überhaupt
mitzuteilen, komplementär scheint“ (Adorno 1956, S. 10).
Andererseits
bringt die Kultur die „Seele unter Kontrolle“ (Holert / Terkessidis
1996, S. 12), „inszeniert die Differenzen als Einheit“ (Adorno
1966, S. 41) und entspricht so genau dem „vereinheitlichenden Apparat“,
den Adorno so befürchtet, und in dem er „die vollständige Totalität
der bürgerlichen Gesellschaft“ verwirklicht sieht (ebd.).
Da
es in der Individual-Kultur nun nicht mehr um die Autonomie des Menschen geht,
sondern um Unterschiede, hat sich der kulturelle Kosmos folgerichtig in einen
„monumentalen Differenzbauchladen“ (Terkessidis 1999, S. 24)
verwandelt, der - im Bündel gekauft als individueller Stil bezeichnet - zum
Remix des Realen wurde, und als neue ethische Avantgarde sowohl eine „Moral
der Pflicht zum Genuss“ (Bourdieu 1987, S. 576), wie auch eine neue Form
der Wahrnehmung des Realen erzeugt hat.
Ausgerechnet
in der eigenen Freizeit wird ununterbrochen am Ego gearbeitet. Kritisch beäugt
man sich selbst und die anderen: „Wie kann ich etwas besonderes werden,
wie kann ich meinen eigenen Stil entwickeln, wie kann ich mich
unterscheiden“ (Terkessidis 1999, S. 24)? Wer dem permanenten
Check nach guten oder bösen Zeichen ausgesetzt ist, will in Ebenen
vordringen, in denen vorher noch keiner war, um dann wieder die anderen auf
Differenz zu checken. Zwangsläufig sieht man so die anderen als Rivalen und
unterwirft sich selbst der ständigen Kontrolle, im Fitnessstudio wie auch bei
der Karriereplanung.
Die
Kultur der Selbstbestimmung erlaubt es den Individuen, Konzepte der
Zeichen-Produktion und –Konsumtion zu gestalten, die ehedem als widersprüchlich
und falsch angesehen wurden (z.B. ein Abonnement von Manager Magazin und von
taz; vgl. Kapitel II). Insofern ist die vormals geforderte Homogenität von
Verhaltensweisen, die man auch als authentischen Lebensentwurf
bezeichnen konnte, obsolet. Jetzt gehört es zu einem aufregenden Lebensstil,
auf verschiedene Aufgaben in unterschiedlichen Situationen mit den jeweils passenden
Reaktionen zu parieren. Als verrückt und hip gilt, wer den möglichst
schnellen Einstieg in die jeweils neue Situation mit Distinktionsvorteilen
gegenüber den Anwesenden abschließt.
Damit
präsentiert sich die kulturelle Originalitätsproduktion als konkurrenzkampfförmiges
Verhältnis: jede „Neuerung, Denkstil, Sprachform und Lancierung wird den
jeweiligen Produzenten zugeschrieben“ (Diederichsen 1996a, S. 151); „der
Aufbau kulturellen Kapitals.....ist damit erheblich den economies of speed
unterworfen“ (Liebl 2000c, S. 153).
Auf
dem Lebensweg werden nun alle Distinktionsvorteile, die sich anbieten
eingesammelt und mitgenommen. Kreative und all jene, denen die Zeit dazu
bleibt, beweisen sich darin als ausgesprochen eigenständige Zeichensurfer,
alle anderen benötigen die in Waren verpackten Applikationen, um sich mit der
angemessenen Differenz im Spiegel betrachten zu können. Hat man letzten Endes
via Konsum zu sich selbst gefunden, liegt dies aber wiederum nur an den
anderen, weil nur der Vergleich vor Publikum die gewonnene Individualität
bestätigt.
So
offenbart sich die Gemeinschaft als Ladentheke der Selbstzuschreibungen, „zum
klaustrophobischen Universum des Privaten“ (Terkessidis 1999, S. 24).
Auf dem Weg zur Solidarität, der quasi amtlichen Bestätigung für alle
Spezialindividuen durch die warme Gemeinde, stolpern die Konsumenten paradoxerweise in Kooperationen mit
Einkaufszentren, Stars und Fernsehsendungen, welche die anderen
Individualisten/Rivalen ebenfalls bedienen. Kaum die Ladentheke verlassen, hat
sich jeder mit noch mehr Rivalitäten eingedeckt.
Strukturell
ähneln sich die beiden Phänomene Hochindividueller Selbstbestimmer =
Moderner Mensch und Kapitalismus so sehr, dass deren beider Tätigkeiten
in synonymen Interessen münden. Beide bedienen sich aus dem Fundus an
kulturellen Zeichen, wobei die Aktivitäten sich nicht decken, sondern der
ganze Prozess eher als vertikale Integration oder schlicht als partnerschaftliche
Kooperation bezeichnet werden kann. Ein Geben und Nehmen in einer
harmonischen Partnerschaft personifiziert quasi das Unternehmen und
verunternehmert das Individuum. Schwierig wird es für die Wirtschaft
nachzukommen, wenn die Konsumenten die Zeichen so schnell verändert sehen,
dass die Warenproduktion nicht mehr nachkommt.
Der
Konsumentenwunsch nach Differenz bringt die Wirtschaft zudem in die Misere,
sich ständig in die noch unkapitalistischen Regionen (Szenen, die als
Subkulturen gelten) einkaufen zu müssen, wenn die Trendscouts den ästhetischen
Entwicklungen nicht nachkommen oder falsche Prophezeiungen getroffen
haben. Der Kapitalismus formuliert seinerseits permanent neue Zeichen, indem
er technische Zukunftsvisionen entwickelt (z.B. Wap Handys), die einerseits
erst durch die Individuen geprüft werden müssen, die aber andererseits
zurecht Hoffnung auf neue Streams machen, indem sie noch gar nicht
dekodiert worden sind. Die Kombination aus Zukunftsangst, Ästhetik und
Technik formuliert im besten Falle für die Unternehmen der New Economy
eine Ideologie der Zukunft, welche die Konsumenten wiederum vor die
Herausforderung stellt, die Zeichen der Zukunft – und damit die Zeichen des
Jetzt - neu zu überdenken.
In
der Massenproduktion von z.B. Mobiltelefonen und der damit verbundenen Vision
einer so-und-so-artigen Zukunft lässt sich für den Kapitalismus
geschickterweise das Bild einer demokratisierten Zukunft herstellen, was als
Illusion eine grandiose Kompatibilität mit
dem Wunsch der Konsumenten (auch der elitären Selbstbestimmer) nach einer
heilen Welt entspricht. Handys für alle bedeutet in diesem Kontext
jeden in die Zukunft zu integrieren; sie gestalten sich so als die Blue
Jeans von heute (vgl. Kapitel VII A).
Politisch
gesehen stellt sich die Frage, ob all diese Entwicklungen im Laufe der Zeit sämtliche
Potentiale der Kunst wie auch alternativer Projekte so vollständig aufgegeben
haben, dass sie bald jenem rundum informierten und aufgeklärten
Selbstbestimmer/Menschen entsprechen, den Slavoj Zizek den „zynischen
Untertan“ genannt hat (Zizek 1996, S. 88): Gerade weil er alle
Symboliken und Verhältnisse kennt, ist er zur Aktion völlig unfähig
geworden, und damit für die jeweiligen Regimes um ein Vielfaches angenehmer
als irgendwelche Barbaren, Big Bürger und Rückständigen
(vgl. Kapitel III A und III B).
1.
The Kitchens of distinction – die Waschküche der
Trendforschung
-
Sie werden dann von Individuen/Konsumenten abgelehnt und sind
zum scheitern verurteilt.
-
Trends können nicht von der Ökonomie kommen; wenn diese
versucht einen Trend zu installieren, waren die dafür notwendigen Zeichen
meist schon vorhanden, nur wurden sie nicht ökonomisch genutzt.
-
Wenn Firmen (Marken) an einem Trend partizipieren wollen, müssen
sie sich schon im Stadium des Gegentrends und unter Insidern einer
verschworenen Gruppe (z.B. einst die pizzamampfenden bärtigen Apple Fans)
einnisten, um später die notwendige Authentizität vorweisen zu können (zum
Erkennen der coolen Zeichen, die eine Gegenkultur besitzt, sind im übrigen
die meisten Unternehmen aufgrund ihrer ökonomischen Mission nicht fähig).
-
Die Wirtschaft muss also, will sie dennoch das Wagnis eingehen,
eines Tages an einem eventuellen hoffähigen Zeichenmix teilzuhaben, auch das
Risiko eingehen, steckenzubleiben (pleite zu gehen)....wodurch allerdings
der Aktienkurs gegen 1 EURO gehen kann (aus dem imaginären Leitfaden für
Existenzgründer, in: www.Stay-Cool-Stay-Rebel.com).
Die dargelegten Thesen werden nun diskutiert:
Die
Trendforschung hat ein Legitimationsproblem. Diese Einsicht ist inzwischen
auch in die Trendbüros selbst vorgedrungen, die sich nun umsehen müssen, wer
noch ihre coolen Ausführungen zu irgendwelchen Phänomenen braucht. Warum das
so ist, liegt auf der Hand: Trendforscher bezogen ihre analytischen
Meisterleistungen in der Regel auf sich selbst, sie machten sich dabei selbst
zum Trend (vgl. z.B. Markenkult von Horx, ein Buch, das vor Selbstgefälligkeiten
nur so strotzt), anstatt die heiligen Marken zu preisen, von denen sie
abhingen.
So
hat sich heute selbst im Mainstream das Gefühl durchgesetzt, bei Trends
handelt es sich um etwas Unechtes, Kurzfristiges, was in jedem Falle die nächste
Jahreszeit/Kollektion nicht überdauern wird. Nein, den Trend setzt man sich
nun selbst, jeder ist sein eigener Trend. Der Kampf um den Trend scheint
vorüber (Liebl 2000, S. 7). Können sich also nun wieder alle auf solide
Werteordnung einstellen, die auch noch für die Enkelkinder gültig sein wird?
Mitnichten.
Zwar hat sich die Trendforschung durch den Zwang, permanente neue Trends
erfinden zu müssen, früher oder später selbst überflüssig gemacht, doch
ist damit das Konsumentenverlangen nach Differenz und Distinktionsgewinn
(Baecker 2000, S. 17) nicht verschwunden. Viel eher lässt sich das Scheitern
der Trendforschung darauf zurückführen, dass nicht erkannt wurde, dass sich
Trends nicht aus Projektionen bestehender Verhältnisse in eine aufgepeppte
Zukunft entwickeln, sondern sie sich zumeist aus gänzlichen Gegensätzen
heraus bilden; aus Gegensätzen, die in der jeweiligen Gegenwart noch gar
keiner Bewertung unterzogen worden sind und so kaum vorvollziehbar sind. Und
wenn sie das doch sein sollen, muss zumindest eingestanden werden, dass Trends
zwar faktisch planbar sind, aber der resultierende Erfolg mit einer anderen
Zeichenkonstellation zweifellos genauso durchzusetzen wäre.
In
der verkrampften Projektion von Zukunft auf die Jetztzeit liegt ein weiteres
Problem der Trendexploration: Warum liegen die Zutaten für die Trends in der
Zukunft und nicht in der Vergangenheit oder der Gegenwart? Tatbestände und
Entwicklungen aus der Vergangenheit sind objektiv doch deutlicher
nachvollziehbar als die nebulöse Zukunft. Die Antwort liegt in der Tatsache,
dass die sozialen Bereiche, für die Trends vorrangig produziert werden sollen
(also Konsumenten und Nicht-Konsumenten) genau den selben Zeichenfundus
besitzen, den die Trendforscher vermeintlich besser kennen. In diesem Sinne wäre
die Beschäftigung mit der Vergangenheit eine Reflektion, die mit den Träumen
der anderen nicht übereinzustimmen scheint.
So
durchschauen die Individuen schlicht und einfach die Resultate der
Trendforschung (die sie ja in Form der Waren verkörpert sehen) als einen Mix
aus bekannten Zeichensystemklassikern (Coca-Cola) und zumeist willkürlich
applizierten Differenzpartikeln (3° C). Solche Zweit- oder
Drittverwurstungsversuche (Cola bei 3°) müssen ja von den Trendleuten
kommen, wer soll einen solchen Schwachsinn sonst erfinden? In der Tat
lassen verzweifelte Markenanarchisierungsversuche oft keinen
Zusammenhang zum Realen erkennen, was Konsumenten dann wirklich als
inauthentische Inauthentizität erkennen und verwerfen.
Denn
wenn Verbraucher den Marken deren Echtheit nicht abnehmen, wünschen sie, dass
diese sich wenigstens bei ihrem zum Scheitern verurteilten Versuch,
Authentizität vorzugeben, authentisch verhalten sollen. Marlboro beweist z.B.
recht erfolgreich, dass es möglich ist, den Traum der Zigarette nach
unendlicher Freiheit zu verwirklichen, indem die Marke bewiesen hat, größtmögliche
Anstrengungen darauf zu verwenden, Abenteuerreisen in die verwegensten Ziele
dieser Erde zu veranstalten (Marlboro Abenteuer-Reisen).
Obwohl
Marlboro sicherlich nicht die ersehnte Freiheit realisieren wird, stellt die
Marke in Form der Abenteuer-Reisen zumindest eine Arbeitsbasis zwischen Marke
und Verbraucher her. Ganz anders sieht das indes aus, wenn die selbe Marke
Marlboro als Sponsor und Organisator inszenierter Drum & Bass-Abende, die
alle unter dem Motto „The Pulse of America“ veranstaltet werden,
auftritt (vgl. Liebl 2000e, S. 1). Dann ist dies nämlich ein Beweis für den
kulturellen Dilettantismus und den offensichtlichen Mangel an „authentischer
Inauthentizität“ (Grossberg 1994, S. 13) seitens eines Vertreters der
Ökonomie. Was Drum & Bass angeht, sind die USA nämlich ein
Entwicklungsland, so dass Marlboro Schwierigkeiten damit hatte, überhaupt -
und dann auch nur zweitklassige - DJs aus den USA zu bekommen, die aber
ausschließlich britischen Drum & Bass spielen mussten, weil es keine Drum
& Bass Platten aus den USA gibt.
Und schließlich
und endlich sieht sich die Ökonomie doch wieder dem Vorwurf der Illegitimität
ihrer Aktionen ausgesetzt, sie kann eben doch nur der bloße Warenlieferant
und Hofnarr der Szenen und Subkulturen sein, bei denen sie doch verkrampft um
Verständnis bittet. Jedenfalls fällt auf, dass es im Feld der Ökonomie
immer wieder um die Frage der gelungenen Vermaterialisierung der Zeichenkosmen
geht, während kulturelle Instanzen wie Theaterhäuser oder unabhängige Kinos
immer mehr auf die Sympathien durch deren Konsumenten zählen können. Oder
ist schon jemals die Frage aufgekommen, wie moralisch OK oder nicht OK das
dissidente Treiben eines Theaterintendanten Frank Castorf oder eines
Filmemachers Lars von Trier ist?
Die
Antwort lautet: Nein. Denn während Trendscouts voraussetzen, dass die
Zeichen von ihnen auf Tauglichkeit bewertet, dann verwertet oder verworfen
werden dürfen, und sie davon ausgehen, dass ihren eigenen Zeichen (von denen
sie denken, sie seien die besten) sich als richtig erweisen werden,
respektiert kulturelles Treiben die Gleichheit der Ausgangspositionen zwischen
den Bereichen Ökonomie und Kultur, und sie unterlässt vor allem die totalitäre
Liquidation aller Werte und Interpretationsmöglichkeiten zwischen den beiden
Polen richtig und falsch.
Indem
die Kultur die komplexen bis paradoxen Konstellationen zwischen einem richtig
und einem falsch erkennt und thematisiert, bleibt sie den tatsächlichen
Mentalitäten der hochindividuellen selbstbestimmenden Differenzentrepreneure
in deren Empfindungen und Vorstellungen näher als die in konkreten
Ergebnissen interessierte Ökonomie, deren Mechanismen der Logik noch immer
nach der alten Methode Problem – Problemerkenntnis – Analyse –
Zielvorgabe – Ziel - Ziel erreicht - Feierabend
zu arbeiten scheinen.
Beim
Spagat Nutzen 1
Authentizität scheitert die Marktwirtschaft in ihren bisherigen materiell
orientierten Aktionen auf dem Marktplatz der Zeichen und Ästhetiken an
schierer Deplacierung. Der Unterschied zwischen einer Analyse von Trends und
Moden im Rahmen der kapitalisierenden Nutzenmaximierung und einer Reflektion
über Interessen und Repräsentationen als freier Disziplin liegt demnach in
dem in den jeweiligen Bereichen festgefahrenen Verhältnis von Kultur und
Kapitalismus.
So
amüsieren sich die Konsumenten weiterhin in den kulturellen Nischen, und die
coolen Zeichen lassen sich nur mit aller Anstrengung aus dem Theaterhaus in
das Imageprospekt des Unternehmens transferieren. Der Traum einer jeden
Jugendmarke vervollkommnet sich nach wie vor in den Sphären und Szenen, die
sich querstellen. Nur so kann Frank Castorf mit den Worten brillieren: „Das
Theater ist ein Königreich. Er kämpft wie ein Berserker um ein volles Haus -
und hat das jüngste Publikum in Deutschland“ (Castorf 2000, S. 1).
Wie
es die Ökonomie dennoch schafft, Eintritt in die subversiven Räume der
individuellen Kulturenmarmelade zu bekommen, und dabei sogar auf
partnerschaftliche Kooperationen mit den Konsumenten hoffen kann, wurde
bereits in Kapitel III D 4 angedeutet und wird sich detailliert in Kapitel IX
B auflösen.
|
|
„Weil
Politik nicht mehr möglich ist, ist alles offen. Weil alles offen ist,
ist alles möglich. Außer Politik.“
|
Obwohl
sich Ästhetik nicht als Erfindung des postmodernen Zeichen-kapitalismus
offenbart – selbst der Barbar verspürt beim Tragen des dunkelroten Mantels
aus Samt einen Hauch von Königlichkeit -, hat sich mit dem Verschwinden der
politischen und existentiellen Sorgen eine Art Hochkonjunktur für die Ästhetik
entwickelt. So hat z.B. der Verfall eines antikapitalistischen Systems, wie
das des ehemaligen Ostblocks, welches in seiner Existenz und politisch-militärischen
Willensäußerung immer einen Gegenentwurf zum kapitalistisch-westlichen
Treiben bot, und für alle Beteiligten einen gehörigen Batzen an
existentieller Restnot darstellte, mit seiner Auflösung die ehemalige
westliche Nutzendoktrin hin zu einem immer mächtigeren, härteren und größeren
Warenarsenal irreal und absurd werden lassen. Es scheint im Nachhinein, als ob
quasi an einem einzigen Tag sämtliche bis dato gültigen Objektive auf den
Sperrmüll der Geschichte gebracht wurden und von da an neue Orientierungen
gefunden werden mussten.
Inzwischen
gilt der kapitalistische Markt, der in ganz traditionellem Sinne die Reichen
immer reicher macht und die Menge der Unbrauchbaren immer größer werden lässt,
allgemein als unantastbar. Mehr noch, er gilt als Allheilmittel, welches
selbst vormals politisch-solidarische Grundtatbestände einer demokratischen
Gemeinschaft, wie z.B. die gesetzliche Altersrente, nun durch die
finanziell-effizienzorientierte Bearbeitung gänzlich in Frage stellt. In
diesem „zivilgesellschaftlichen Totalitarismus“ (Joachim Hirsch,
in: Holert/Terkessidis 1996, S. 15) ist offenbar im sozialen Leben außer der
individuellen Selbstverwandlung in einen „erfolgsadäquaten Apparat“
(Adorno/Horkheimer 1944, S. 134) kein Handlungsentwurf mehr vorgesehen. In der
postmodernen Gesellschaft wird aber jegliche Kritik am kapitalistischen
Prinzip deshalb schwierig, weil das Werte- und Klassensystem gesellschaftlicher Selbstbeschreibung kulturalisiert worden
ist. „Was zuvor noch wirtschaftlich oder politisch interpretiert werden
konnte, lässt sich jetzt nur noch durch die Brille der Kultur betrachten. ...
Soziale Unterschiede gelten heute als konsumistische Stilprobleme, und soziale
Auseinandersetzungen können nur noch als symbolische Kämpfe wahrgenommen
werden.“ (Holert/Terkessidis 1996, S. 17).
Ehemalige
Klassenkämpfe, wie z.B. die zwischen den Chefs in Nadelstreifen und
den ausgebeuteten Arbeitern sind im Zuge der Verunternehmerung der
Individuen inzwischen überflüssig geworden. An deren Stelle treten nun
Gesellungsformen, die zumeist „frei gewählt, nicht exklusiv, meist ästhetisch
motiviert und in der Regel nur von begrenzter Dauer sind“ (Liebl 2000c,
S. 132). Die „Ästhetisierung in allen Lebensbereichen“ (Sedlack
2000, S. 109) schafft nun für alle Individuen Möglichkeiten der Distinktion
und des Erlebens durch kulturelle Differenzierung. Alles wurde einem
postmodernen Facelifting unterzogen: „die Plätze, die Fußgängerzonen,
die Passagen, die Fassaden, nichts blieb vom Ästhetisierungs-Boom verschont“
(ebd.).
Auf
dieser Ebene bedeutet Ästhetisierung soviel wie „Ereignisinszenierung
zur Lustversorgung einer Freizeit- und Erlebnisgesellschaft, wobei (...) das
Amüsement, der Genuss ohne Folgen - dominiert“ (Welsch 1993, S. 14),
und „nötigenfalls wird die Inneneinrichtung die Möblierung der Seele
komplettieren“ (ebd.). Durch die Vielfalt an ästhetisch zu den
Individuen und deren jeweiligen Szenen besser oder schlechter funktionierenden
Formen hat sich ein Wettbewerb um die coolen Zeichen entwickelt, der
sich beispielsweise im „Kampf ums Logo“ oder im „Kampf um das
richtige T-Shirt“ äußert (Liebl 2000c, S. 132).
Das
sich permanent reproduzierende Suchen und Finden nach immer subversiveren
Zeichen in den Mikro- und Makrokosmen der Kultur deutet sich am
vielschichtigsten und offensichtlichsten in den sogenannten Trends an, die
sich „gleichzeitig als Ausdruck von Vergemeinschaftung unter Bedingungen
fortgeschrittener Individualisierung auffassen“ (Liebl 2000c, S. 133)
lassen. Vor dem Hintergrund der beschriebenen „Betonung von Differenz“ (Mayer
1996, S. 153), die Franz Liebl im Hinsicht auf das Konkurrenzverhalten der
Konsumenten und Szenen als „Style Wars“ bezeichnet, lassen sich
Trends folglich als „Ausdruck der Krisenhaftigkeit des Kapitalismus“
(Liebl 2000c, S. 132) charakterisieren.
Das
Phänomen Trend beweist sich also als probates Ausdrucksmittel für das
Abfeiern als postmodernes Prinzip, den angenehmen Zustand darzustellen, dass
man sich im postmodernen Konsumentenstadium in einer Gesellschaft ohne
existentielle Nöte befindet. Wenn es in der Moderne darum ging, die Grundbedürfnisse
nach Schutz und Frieden auf eine Spitze zu treiben (alte S-Klasse), geht es im
postmodernen Sinn darum, zu feiern, dass es die Grundbedürfnisse nicht mehr
gibt. Die Postmoderne stellt sich als die postmaterielle Epoche dar.
Die
Existenz von Grundbedürfnissen zuzugeben wäre nur peinlich, die kulturelle
Repräsentation ist an deren Stelle getreten:
Exkurs: Aufgabe: Vernimm von Deinem Bekannten:
„Ich gehe in den Wald, Bäume fotografieren“, und beschreibe nun
was in Dir vorgeht!
Zunächst
wäre zu sagen, dass die Art der Rezeption dieses Satzes von der Persönlichkeit
Deines Bekannten abhängt: Falls es sich bei ihm um einen Fotografen handelt,
ist diese Aufgabe nutzlos, denn der Sinn des Satzes scheint klar: Der Bekannte
geht dem nach, was seinen Beruf oder seine Passion ihm vorgibt. Falls es sich
bei dem Bekannten aber nicht um einen Fotografen handelt, sondern um einen
Jura-Studenten, der zum ersten Mal in seinem Leben in den Wald zum
Fotografieren will, fängt nun der zweite Teil der Aufgabe an: Bilde zwei Fälle,
und sei im ersten Fall ein Mitstudent der 70er Jahre, und sei im zweiten Falle
ein Kommilitone im Jahr 2001. Was geht jeweils in Dir vor?
Im ersten Fall ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass
Dich der Wunsch des Bekannten zum einen angenehm überraschen wird, und zum
anderen, dass die Aussage in Dir Verständnis dafür wecken wird, dass der
Bekannte sich nach natürlicher Umgebung, aufrichtiger Kontemplation, Ruhe und
Passion sehnt. In der Aussage des Bekannten verbirgt sich sein Wunsch nach dem
Wesentlichen im Leben, er möchte seine rudimentären Sehnsüchte befriedigen,
und diese Herzenswünsche im besinnlichen Umgang mit der Natur für sich
dokumentieren. In diesem Sinne verneint er die vorgegebenen Handlungsentwürfe
der elterlichen eingeschlossenen Fabrik-arbeiterschaft, und rebelliert mit
seiner Suche nach Freiheit gegen die bürgerlich entschiedenen Normen; er
handelt also im traditionellen Sinn politisch.
Im zweiten Fall ist die Lage nicht so einfach: Zwar überrascht
Dich auch hier die Aussage des Bekannten, sein Tun ist ganz und gar ungewöhnlich.
Hier ist aber sehr viel wahrscheinlicher, dass Du seinen Wunsch als peinlich
und kitschig dekodieren wirst. Du wirst vielleicht finden, dass der Bekannte wohl
gerade seine romantische Phase hat. Gleichzeitig steht hier nicht im
Vordergrund, ob und wann sich der Bekannte tatsächlich in den Wald zum
Fotografieren begeben wird, sondern die Botschaft steckt in seiner Aussage. So
weißt Du, dass er sich ein bestimmtes Persönlichkeitsbild verleihen will,
oder ein bereits bestehendes Image aufpolieren möchte. Bist Du zudem eine
Frau, ist es wahrscheinlich, dass Du weißt, dass Du in der Aussage des
Bekannten seinen naturalistischen und einfühlsamen Charakter erkennen sollst.
Ob der Bekannte nun tatsächlich irgendwann in den Wald zum Fotografieren
geht, und damit seine Glaubwürdigkeit beweist, ist letzen Endes egal, denn
der Bekannte stylt sich in seinen Distinktionsvorteil hinein, der in Zukunft
sein einzigartiges Charisma erweitern soll, der ihn aber nach außen eventuell
zum peinlichen Idioten werden lässt. Sein ideelles Fett kriegt er in jedem
Fall von Dir und den anderen ab, bleibt er doch in seiner Existenz völlig
konform und ungefährlich für jegliche Ordnungsinstanzen.
Wir
fürchten uns vor jeglichem Wesentlichen, vor der Peinlichkeit des Natürlichen,
vor dem Kitsch des Rudimentären, vor der Verbindlichkeit des Politischen. Und
stürzen uns in das Abfeiern unseres Lebenszustandes über der
Grundversorgung, und ähneln Kriegsflüchtlingskindern, die froh darüber
sind, dass sie sorgenfrei leben und keine materiellen Nöte erleben müssen.
Trends
sind unmittelbar im Pakt mit der Leugnung von materiellen Untergrenzen. Die
Diskussion über Trends ist also immer eine Diskussion der Beteiligten in der
1. Welt über den Wohlstand in der 1. Welt – die Reichen feiern sich selbst.
Die Einbeziehung von materiellen Missständen, Hunger und Grundbedürfnissen wäre
tödlich für die Produktion und Konsumtion der styles, tribes &
extremities. Auch deshalb sind Reflektionen über Trends, Ästhetiken und
Zeichen immer auch Gedanken über den Kapitalismus, der das System der
globalen Ungleichheiten aufrecht erhält. Denn, wie Johan Galtung sagt, ist
„jeder Narr in der Lage, ein ökonomisches System zu schaffen, in dem
reiche Leute teure Güter kaufen können“. „Was jedoch Können und
Talent erfordert, ist eine Ökonomie zu schaffen, in der die Grundbedürfnisse
von (fast) allen befriedigt werden, ... und in der auch die mentalen und
spirituellen Bedürfnisse nach Freiheit und Identität befriedigt werden“
(Galtung 2000, S. 44).
Sub-
und Gegenkultur als unendliche Ressource von subversiven, sprich
unkontrollierten Zeichen, ist seit der Entstehung von Popkultur unmittelbar
mit dem Ideal der Jugend und Jugendlichkeit verknüpft. Zur Formierung der
Popmusik zu einer Schlüsselindustrie haben die Jugendlichen selbst durch ihre
Verneinung einer streng geordneten Bürgerlichkeit und der Fabrik als
Einschließungsregime beigetragen. Und „wenn Elvis mit den Hüften
wackelte, dann forderte er zur Flucht aus dem Gefängnis des reglementierten
Alltagslebens auf“ (Holert/Terkessidis 1996, S. 13). Mit Hilfe
kultureller Zeichen wurde zum ersten Mal der Wunsch nach Auflehnung gegen die
Kulturindustrie laut, die vorher nur dazu gedient hatte, „die Seele unter
Kontrolle zu bringen“ (Terkessidis 1996, S. 117). Die Funktion von
Popmusik als einer Rebellion gegen gesellschaftliche Normen war von daher
schon immer eingebunden in den Mythos der jugendlichen Aufruhr. Dass dieser
Mythos der Auflehnung und der Jugendlichkeit von der Kulturindustrie kooptiert
und so lange wie möglich am Leben erhalten wurde, wurde für die
Konsumrebellen der Generation X erst später klar. Spätestens aber seitdem
der Rebell zum natürlichen und zentralen Bild auch der kontrollierten
Massenindustrien geworden ist, wird es für die Konsumenten zu immer
schwierigeren Aufgaben, Echtheit von Falschheit zu unterscheiden. Inzwischen
stellt sich jedoch die Frage nach Authentizität selbst für die subalternen
Szenen nicht mehr: alles kann echt sein, solange es auf die richtigen
Dekodierexperten trifft.
Heute
arbeitet fast jede Form von Werbung mit den jugendlichen und dissidenten
Idealen einer Gesellschaft, die den Mangel nicht kennt, und die so anstelle
der früheren Leitbilder Arbeit, Karriere, Besitz, Familie und Eigenheim, ihre
neuen Werte ins Zentrum ihres konsumistischen Lebens stellt: statt Sparsamkeit
Geldausgeben, statt Genügsamkeit Stil, statt Dauerhaftigkeit Wegwerfprodukte,
statt Aufschub von Bedürfnissen deren schnelle Befriedigung. Dabei unterschlägt
die Kooperation von Konsumenten und Industrie die Tatsache, dass es den
politisch rebellischen Gegenentwurf der vergangenen Epochen schon lange nicht
mehr gibt. Die neue Ordnung stellt heute eine Homogenität an Lebensmodellen
und Handlungsentwürfen dar, „die Differenzen als Einheit inszeniert“
(Gurk 1996, S. 35). Obwohl es die Notwendigkeit eines James Dean als einem rebel
without a cause nicht mehr gibt, verarbeitet die Kultur- und
Werbeindustrie dennoch alles, was Identität durch Differenz verspricht.
Gleichzeitig
hat die massenmediale Abschaffung jeglicher Machtwirkungen, die an
elitistisches Wissen gekoppelt sind, die Konsumenten demokratisiert, so dass
sich nun z.B. im Fernsehen die Erlebnisgemeinschaft Fernsehstation und
Zuschauer gegenseitig in einem permanenten „kulturzerstörerischen
kulturellen Konformismus“ (Bourdieu 1998, S. 77), der es locker mit dem
nervösen aber dennoch statischen Zusammenspiel der Beteiligten in Sartres Geschlossene
Gesellschaft aufnehmen kann, immer intensivere und identischere
Differenzkonstrukte zuspielt, und dadurch dem anderen immer seine
Homogenität und Loyalität beweist. „Jeder beobachtet jeden“,
und „jede Innovation verwandelt sich sofort in Routine“, wodurch
sich die Kristallisierung wirklicher Formen von „Selbstüberschreitung
und Antithese“ (Schulze 1999, S. 72), und damit von Differenzen, die
auch jenseits von Selbstzuschreibungen vertretbar sind, schwierig gestalten.
Auf der einen Seite recyceln sich die Systeme somit ständig selbst, „die
Medien faszinieren und langweilen deshalb gleichzeitig“ (Schulze 1999,
S. 73), auf der anderen Seite stellt sich die Frage, inwiefern in diesem
geschlossenen Kontrollmechanismus die angebliche Demokratie für die
Individuen/Zuschauer tatsächlich Frei- und Gestaltungsräume bietet. Besitzen
die Thesen von Adorno und Horkheimer also immer noch dahingehend Gültigkeit,
dass die „kulturindustrielle Massenproduktion das Supplement eines
autoritären Fürsorgeregimes darstellt“ (Adorno/Horkheimer 1944, S.
134)? Oder kann die Kulturindustrie zwangsläufig nicht wirklich subversive
Zeichen herstellen, weil sie sich ja damit selbst gefährden würde? Ist das
faszinierendste, was die Kulturökonomie zustande bringt also eine
systemkonforme anschlussfähige Zeichenproduktion, die sich zwar neuartig
darstellt, jedoch hinreichende Verbindung zu bisher Bekanntem zulässt, was
dem aus der Trendforschung geläufigen MAYA-Prinzip (Most Advanced Yet
Acceptable) (Liebl 2000c, S. 152) zur Produkterfolgsoptimierung durch
entsprechendes Marketing entspricht? Solange die Beteiligten im sozialen
System sich zu wohl mit der ihnen zugedachten Rolle fühlen, und nicht bereit
sind, diese Rolle aufzugeben, scheint zumindest für den kulturellen
Mainstream die Erfindung subversiven und damit interessanten Zeichenmaterials
nicht möglich.
Auch
für vermeintlich rebellische Jugendkulturen entsprechen dann die von ihnen
produzierten und konsumierten Zeichen immer noch der unproblematischen
Existenz in einer „Gesellschaft der Gesellschaft“ (Niklas Luhmann
1987, S. 241). „Mit der Flucht aus dem Alltag, welche die Kulturindustrie
in allen ihren Zweigen zu besorgen verspricht, ist es bestellt wie mit der
Entführung der Tochter im amerikanischen Witzblatt: Der Vater selbst hält im
Dunkeln die Leiter. Kulturindustrie bietet als Paradies denselben Alltag
wieder an“ (Adorno/Horkheimer 1944, S. 140).
Auflehnungskämpfe
der Jugendlichen gegen die elterlichen und bürgerlichen Kontrollsysteme
gestalten sich heute als Tendenzen zu anderen Identitäten unter gleichen
ideologischen Bedingungen. Während die Gegenkulturen der 70er Jahre explizit
eine politische Gegenposition zu der bürgerlichen Vorstellung, und damit auch
eine andere Idee einer korrekten Ästhetik mitbrachten (die allerdings immer
zweitrangig blieb), drehen sich heute die Anstrengungen der selbsternannten
Subkulturen nur um Distinktionskämpfe.
Das
vormals Politische ist gänzlich verschwunden, das Ästhetische ist an dessen
Stelle getreten und selbst zum Hauptinteresse geworden. Im Kampf um Ästhetiken
wird also heute im Unterschied zu früher auf die bereits vorhandene bürgerliche
und ökonomische Infrastruktur gesetzt; angeblich Subkulturelles bleibt damit
in seiner Zeichenproduktion immer einverstanden mit den Werten der
Kulturindustrie.
Minderheiten
werden selbst zum Mainstream (vgl. Holert/Terkessidis 1996), das System der
Zeichen besteht nur noch aus der „alles vereinnahmenden und
vereinheitlichenden Kulturindustrie“ (Adorno/Horkheimer 1944, S. 118),
vor der Adorno schon gewarnt hat; allerdings mit dem Unterschied, dass
Adornos Konformitätsthese sich heute auf einem höheren Level bestätigt, nämlich
indem sich das ganze als eine Ordnung aus unendlichen Mikrokosmen darstellt,
so dass die Festsetzung von Gegenbegriffen und subversiven Handlungsentwürfen
in den Szenekosmen in Form von Szenekämpfen verhaftet bleibt.
Das
Politische bleibt unter sich, die Beteiligten greifen sich selbst an, indem
sie sich permanent kontrollieren, stylen und doublechecken. So lässt es die
massenmediale Gesellschaft nicht zu einer vernehmbaren Klage eines
vermeintlichen Dissidenten kommen, ohne dass dieser sich in seinem Akt der Empörung
auch gleichzeitig mit ihr aussöhnt. Dissidentes Verhalten – außer in Form
von Verbrechen und Gewalt -, fügt sich in den Trend der Mainstreams ein.
Löst man
sich vom Status und den Hierarchien, erfährt das Erlebnis Besitz
einen Paradigmenwechsel vom materiell Okkupistischen zum visuell
Ideologischen, das es jedem ermöglicht Dinge, Menschen und Situationen zu
genießen und somit mental für sich zu beanspruchen. Steht der Besitz
jedem frei zur Verfügung, der Augen, Mund, Nase und Ohren hat, handelt es
sich demnach um einen in seiner grundsätzlichen Art demokratischen
Prozess, wenn man so will um eine sozialistische Idee, der dem Kapitalisten
den Vorteil des Besitzes (der in einer auf materiellen Besitz getrimmten
Gesellschaft ja ohne Zweifel vorliegt) raubt, ja den Kapitalisten
eventuell bloßstellt. Besitz im materiellen Sinn wird zu etwas Archaischem,
das irgendwo beim Übergang von der letzten Generation zu der jetzigen
steckengeblieben ist. Übrig bleibt nur der Komfort des Materiellen. Wer den
ständigen Wechsel der Situationen und der Ideologien zu seinem Steckenpferd,
zum subjektiven Imperativ macht, hat zwei Wahlmöglichkeiten. Erstens,
die immer neuen Bedürfnisse und Wünsche, die durch den
permanenten Identitäts- und Standortwechsel entstehen, zu erfüllen. Dies
setzt die Investition von Zeit und Geld in die Erfüllung der Wünsche voraus,
was wiederum die beiden notwendigen Bestandteile Zeit und Geld zu den
Imperativen des Ich macht. Die zweite Möglichkeit ist sicherlich die bisher
weniger reflektierte und in Anspruch genommene. Hier wird das bisher
normative Diktat der Bedürfnisse geändert, indem schlicht das Bedürfnis
selbst in Frage gestellt und als Variable gesetzt wird. Versteht man also das Bedürfnis
als den Besitz, als den Wunsch nach den Dingen, geht es nun darum, die
Eigenschaften des Besitzes zu verändern. Besitz als ein
nicht-materialistischer sondern ideeller Bestand an Möglichkeiten ermöglicht
dann die Erfüllung der Bedürfnisse auf emotionale virtuelle Art und
Weise. We all own the
money if we see and feel it. Diese zweite Möglichkeit wird allerdings nur verstanden,
wenn ein Paradigmen-wechsel stattfindet, der es ermöglicht, vor allem aus der
Popmusik und der Mode bekannte Kulturtechniken (Kopie, Sampling, Remix,
Bricolage, Cross-Over) gesellschaftlich relevant zu machen.
Derlei
Entwicklungen, die zweifelsohne auf den Kapitalismus als monetäres und
materielles System verzichten können, haben sich allerdings in der
Vergangenheit als inkompatibel zum marktwirtschaftlichen System erwiesen. Phänomene,
wie z.B. der bisher im Internet frei zugängliche Musikkatalog Napster,
entsagen in ihrer Aussage dem ökonomischen Prinzip. Sie stellen dafür eine
eigene ökonomische Gesetzmäßigkeit an Zeichen und Symbolen her, die mit der
Logik der Konsumenten anschlussfähig ist, und die in ihrer Intensität an
hyperschneller Zeichenkapitalisierung den beleidigten Unter-nehmen zeigt,
welch immenses Potential in autonom individualistischen Handlungen steckt.
Firmen wie Sony oder Ariola, die sich von ihrem ökonomisch geprägten
Weltbild nicht lösen können, haben nun die leidige Aufgabe, den potentiellen
Käufern ihrer Produkte darzulegen, dass es cool ist, 30 DM für eine CD
auszugeben, es aber rechtlich gesehen illegal ist, sich dieselbe Musik frei
aus dem Netz herunterzuladen. Dass der Reiz des Kaufs einer CD in der
Transaktion Geld gegen Ware an einer anonymen Media- oder Pro-Markt
Kasse liegt, muss aber den konsumierenden Schlingeln erst noch gezeigt werden.
Es gibt einen freien Willen, der den freien Märkten an Attraktivität überlegen
ist. Während Konsumenten Märkte am liebsten als herausfordernde, vielfältige,
extreme und sogar illegale Orte sehen, beweist sich die Ökonomie mit den
gleichgültigen Einkaufsmonstren in Industrie-gebieten ihre eigene Unfähigkeit,
die Bedürfnisse von Menschen zu respektieren. Den interessanten Kunden
haben die Unternehmen bisher zumeist angeboten, ihre Konsumfreiheit in den „Einschließungsmilieus“
(Gilles Deleuze 1993, S. 188) auszuleben, während es den smarten Shoppern
in erster Linie darum geht, ihre Freiheit beim Konsumieren selbst zu genießen.
Das eigentliche Produkt, welches die vermeintliche Freiheit nach dem Kauf
betonen soll, ist in Wirklichkeit uninteressant. Der Kapitalismus muss sich
von der physischen Materialität (Eigentum) in Richtung des ideellen Vermögens
hinwenden, wo doch das starre materielle Kapital der Ökonomie im
Zusammen-spiel mit den individuell zeitspezifischen Bedürfnissen der Kunden
permanent ausgetrickst wird. Man kann sogar noch einen Punkt weiter gehen und
behaupten, daß im sogenannten "kulturellen Kapitalismus" (Zielcke
2000) der Konsum von materiellem Besitz überhaupt nicht mehr nötig ist. Wer
braucht dann noch den Warenverkehr?
Es soll nun
eine Annäherung an das phänomenale Individuum geschehen, und es sollen die
Gründe für die Paradoxien des menschlichen Handelns untersucht werden, auf
die man zwangsläufig stößt, wenn man sich mit Differenz und Homogenität,
mit Avantgarde und Ramsch beschäftigt und dabei merkt, dass sich ja alles
ineinander auflöst. Sind Pop, Kapitalismus und Kultur in einem unguten
Sinn zu rechtsfreien Räumen geworden, in denen Bedrohungen und Irritationen
nicht mehr zu trennen sind? Kann denn mal endlich jemand die Images,
Botschaften und Träume unter Kontrolle bringen? Kann denn Liebe Sünde sein?
(......frei nach und im Sinne von Michael Douglas in Falling Down).
|
|
„Im
klimatisierten Auto multikulturelle Radioprogramme zu genießen, ist
eine Sache. In der U-Bahn oder im Bus umgeben zu sein von Menschen,
deren Sprache man nicht versteht, das ist die andere.“
(Johannes
Rau, Berliner Rede, Mai 2000, in: Holert 2000, S. 24)
|
Der
feuilletonistische Chic hat die Zeichen der Zeit erkannt und sieht in den
unkontrollierbaren kulturellen Symboliken der Jugend- und Gegenkulturen
Gefahren und Uneindeutigkeiten, ohne zu wissen, wovon er spricht. So war vor
kurzem in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, in den USA entwickle sich
zwischen schwarzem Hip-Hop und Country eine neue rechte Popkultur. Sogar die
Cowgirl-Inszenierung auf dem Cover von Madonnas neuem Album wird zum Indiz für
den vermeintlichen Rechtsruck in der Welt der jugendlichen und erwachsenen
Pop-Idole. Der Übergriff der rechtsradikalen Schlange auf die Popkonsumenten
wäre laut Autor Adrian Kreye der nächste Schritt, schließlich produzieren
selbst die gefährlichen Bands aus der rechten Szene „teilweise wirklich
gute Musik......die eine magnetische Wirkung auf junge Zuhörer hat“ (Kreye
2000).
Der
kulturelle Mainstream sieht Gefahren in der unkontrollierten Welt der
subversiven Zeichen und Ästhetiken und entspricht so den Unternehmen aus der
Marktwirtschaft, die sich ebenfalls gern in der lamentierenden Rolle sehen,
die es ihnen unmöglich macht, sich mit neuen Ideen und kulturellen Strömungen
auseinander zu setzen. Immer wenn Botschaften und Images nicht vollkommen
kontrolliert werden können, gerät für die Wirtschaft und die Hochkultur
etwas aus den Fugen. Die Ökonomie stellt dabei mehr zur Schau, dass sie mit
den kulturell subversiven Zeichen nicht umzugehen weiß, als dass ihre
Analysen tatsächlichen ästhetischen Entwicklungen entsprechen, was vor allem
die Zeichenkonsumenten freut, die sich weiter auf unerforschten, rebellischen
Feldern bewegen dürfen.
Es
wird deutlich, dass die bürgerlichen Denkstrukturen der Marktwirtschaft und
des Feuilletons zwar der Beschreibung von Trends gerecht werden können, nicht
aber der Beschreibung kultursemiotischer Phänomene. Denn Madonnas Westernlook
ist bestimmt kein Zeichen für den Trend zum Rechtsruck,
sondern Madonna nutzt vorhandene kulturelle Ressourcen, um sich selbst
in einer Zeichenperformance neu zu erfinden. Gefährlich oder rechts
wird das ganze nur, wenn bestimmte Stigmata aus dem Zusammenhang gerissen
werden. Auf diese Weise verflacht aber, wie Tom Holert anmerkt, „das
Epitheton „rechts“ zu einer analytisch bedeutungslosen Kategorie“ (Holert
2000, S. 25).
Kultur
und Mainstream kommen also in das Dilemma, zwischen wünschenswerter und zu
verurteilender Uneindeutigkeit zu unterscheiden. Die kapitalistische Ökonomie
der Unternehmen und Kulturproduzenten fordert auf der einen Seite soviel
Differenz, Nischen, Marktlücken, Ästhetisierung wie möglich. Die kulturelle
und ordnungstechnische Ökonomie der Unternehmen und Kulturproduzenten fragt
sich auf der anderen Seite: Wie viele coole Zeichen und Ambivalenzen sind in
Ordnung, wie viel Eindeutigkeit und wie viel unkontrolliert unbiologischer
Anbau von Kultur ist noch auszuhalten, damit die Leitkultur in
ihrer Substanz nicht gefährdet wird?
Wenn
es darum geht, dass eine von der Marktwirtschaft lancierte gesellschaftlich
relevante Entwicklung stattfindet, die in ihrer massenhaften Auswirkung tatsächlich
einer Art Leitkultur entspricht, scheint dies niemanden zu stören.
Handys beispielsweise, haben Einzug in alle Schichten und Klassen gehalten und
haben sich langsam jeglichen Kategorisierungen entzogen. Nachdem
sie ehedem mit elitären status- und kommunikationssüchtigen Menschen in
Verbindung gebracht wurden, darf sie inzwischen jeder besitzen. Handys
als die Verkörperung der Illusion um eine soundsoartige Zukunft sind nun von
Grund auf demokratisch und in ihrem
integrativen Kontext unpolitisch. Sie überwinden quasi alle noch bestehenden
Hierarchien aus der materiellen Zeit: Reduce to the max.
Das
Handy, als Abfall für alle ist Sinnbild für die Demokratisierung der
Technik; gemacht von der Gesellschaft für die Gesellschaft; jeder
kontrolliert jeden. Bereit und immer erreichbar für potentielle Aussichten,
stehen alle in Verbindung mit der chancenreichen Zukunft. Die Illusion des in-der-Zukunft-gebraucht-werdens
kann man als Pre-Paid Card immer wieder nachkaufen, oder sich - ganz
ohne Zweifel - in Form eines 24 Monate dauernden Vertragsverhältnisses
sichern.
Das
Neue wird als das Ultimative publiziert, immer mit der Einschränkung, dass
das neue Neue dann das ultimative Neue ist, wenn dieses das dann vormals Neue
abgelöst hat. So
in etwa funktioniert gesetzmäßig jeder Zyklus einer technischen Innovation
im System der Waren. Mit jeder neuen Ware entsteht eine tendenziell qualitativ
bessere Ware, die den Wert der alten Ware mindert. Eventuell kann die
technische Qualität einer Ware nicht mehr gesteigert werden und die Ware ist
generell ein ganzes Menschenleben lang nutzbar. Dann ist es für die Ökonomie
nötig, die Produktion der Ware auf so ein Volumen zu drosseln, dass gerade
noch alle Nachfrager bedient werden, die einen neuen Hausstand gründen oder
die alte Ware aus Versehen oder vorsätzlich zerstört haben, und so eine neue
benötigen. Langfristig hat in einem solchen System (welches im übrigen wohl
als ökologisch perfekt zu bezeichnen wäre), die kapitalistische Ökonomie
nichts mehr zu tun und alle haben nur noch Freizeit.
So
ist es für die kapitalistische Arbeits-, Lach- und Schießgesellschaft
praktisch, dass es ein Volumen an Warenkonsumtion gibt, welches den oben
beschriebenen Zustand erheblich übersteigt. Um die florierenden Geschäfte zu
ermöglichen, hat man das tief menschliche Bedürfnis nach Gesprächen, Träumen
und Gemeinschaft in die Ökonomie übertragen und es fortan Kommunikation genannt. Ihr kommt in dem aktuellen Produktions- und
Konsumtionszustand der 1sten Welt, der einer Art kollektiven Warenbulimie ähnelt,
die entscheidende Rolle zu. Indem den Menschen mittels Symbolzuschreibungen
und kulturellen Zeichen verdeutlicht wird, dass die Waren mehr
wert sind, als sie es ureigentlich waren, eröffnen sich
dem Publikum nun unendliche Bedürfnisvarianten, die den genauso unendlichen
Warendifferenzierungen entsprechen. Es kommt nur noch darauf an, dass die Träume
und die Erfüllung der Träume zur selben Zeit am selben Ort zusammentreffen.
Wir
haben in den letzten Kapiteln herausgefunden, dass es die Kultur bzw. - im
Kontext von These und Antithese, Mainstream und Differenz – die Subkultur
ermöglicht, eine in der jeweiligen Gegenwart als unglaublich erscheinende
Vielfalt an kulturellen Zeichen zu entfalten. Eine kulturelle Vielfalt, die
letzen Endes von der Marktwirtschaft, die bisher aufgrund ihrer thematischen
Beschränktheit unfähig zur Coolness
war, in einer quasi Imitation übernommen wird. Symbolische Innovationen der
Marktwirtschaft entsprechen den zunächst dissidenten Zeichen der kulturellen
Nischen. Beide kannibalisieren sich und ihr jeweils kurzfristiges
Zeichenmonopol, indem sie sich mitten in das Getümmel der Distinktionskämpfe
stürzen, so dass die dabei entstandenen Waren zwangsläufig binnen kurzer
Zeit für einen um die Hälfte reduzierten Preis im Schlussverkauf angeboten
werden, wodurch dann auch ignorante Banausen wie Angela Merkel zugreifen können.
Kulturelle
Zeichen der Marktwirtschaft zu verweigern, hieße Trends zu eliminieren. Doch
schon wenn man sich auf die Straße wagt, befindet man sich mitten in der
Marktwirtschaft. Alles Private verharrt jedoch so sehr in sich, dass es gar
nicht zum kulturellen Diskurs, geschweige denn zu gesellschaftlicher Relevanz
kommen kann. So sind inzwischen Subkulturen, Individuen, Mainstreams, Szenen
und Ökonomien aus der Kommunikation untereinander in eine Symbiose ineinander
übergegangen. Wie eine Gesellschaft aussähe, die auf die Produktion und
Konsumtion kultureller Zeichen verzichtet, wird hier nicht eingehend behandelt
und soll daher nur kurz angedeutet werden: Man stelle sich vor, alle Menschen
auf den Straßen tragen orangefarbene Anzüge (weil orange am praktischsten in
der Nacht ist, da man damit am besten gesehen wird) und beim Bummeln auf der
Autobahn gibt es aber auch gar nichts zu begaffen, dadurch dass alle gleich
aussehen. Wäre dies das Ende jeglicher Kommunikation, oder würden dann die
Menschen aus der Unmöglichkeit der Möglichkeiten erst anfangen miteinander
zu reden?
|
|
„Jetzt ist jeder frei, aber
innerhalb des eigenen Gefängnisses, des Gefängnisses, das er aus
freien Stücken selbst erbaut.“
(Maurice
Blanchot, in: Baumann 1997, S. 186) |
Die
Beschäftigung mit dem kulturellen Kapitalismus in diesem Aufsatz
zeigt, wie sich die gesellschaftliche Ordnung selbst in verschiedene Milieus
und Szenen aufgeteilt hat. So präsentiert sich die Tendenz zur Verszenung
in den Mikromilieus des kulturellen und ästhetischen Bereichs, und auch die
Politik hat sich zu einer straffen und klaren Organisationsform entwickelt,
die der eines Unternehmens ähnelt. Kapitel VIII C wird zeigen, dass sich auch
die Medien in selbstzuschreibenden Milieus finden, in denen das Publikum
indirekt die Rolle eines Mäzens spielt, der letztlich das Treiben der Medien
finanziert.
Nun,
da alle Aufseher und Ordnungsinstanzen verschwunden sind, und sich jeder nur
noch um seinen Bereich kümmert, ist das Individuum sein eigener Wächter und
Lehrer. Das Ich selbst ist zu einem Mikrokosmos mutiert. Die
Deregulierung der Zeit und die Demokratisierung der Möglichkeiten zeigen
allen, dass alle nur noch für niemanden und somit Ich nur für mich
selbst Verantwortung trage. Und da die Kategorisierung und die Ästhetisierung
dieses diffusen Ich zur spannenden Lebensbeschäftigung wurde, sehen
sich alle mit einem heiklen Dauerthema konfrontiert: Wer bin ich?
Wer
heute einen Job will, der muss zu sich selbst gefunden haben und über seine Fähigkeiten
und Möglichkeiten genau Bescheid wissen. Ansonsten, so sind sich
Personalleiter wie auch High- und Low-Potentials einig, hat man
keinen Spaß bei der Arbeit, und das mindert die Leistung immens. In der
ehemals umgekehrten Freizeitwelt ist es genau so: Wer in der Freizeit nicht
genießen kann, dem fehlt es an Persönlichkeit und Herausforderung, der ist
ein Warmduscher. Allerdings ist es nicht einfach, die Persönlichkeit
bei der Stange zu halten bzw. den Mangel an Persönlichkeit zu überwinden.
Schließlich handelt es sich bei der Identitätsbildung nicht um einen
akademischen Grad, der einmal erlangt, einem nicht mehr abgenommen werden
kann. Ganz im Gegenteil wird neben dem starken Selbst vor allem Flexibilität
erwartet; und ein Teil dieser Flexibilität ist es, in einem permanenten
Selbstnachweis das „auf der Höhe sein“ immer wieder neu zu
beweisen. Die Fähigkeit, die hochempfindliche Persönlichkeit sowie den
eigenen Körper zu kennen, heißt diesen in ein Stadium stilistischer
Dauerekstase zu bringen.
„Der
postmoderne Körper ist vor allem ein Empfänger von Empfindungen, er trinkt
und verdaut Erfahrungen; die Fähigkeit, stimuliert zu werden, macht ihn zum
Werkzeug der Lust“ (Baumann 1997, S. 188). Diese Lust entsteht erst
durch das Wissen, dass die anderen bei dieser Stimulierung aufhorchen, dass
die anderen dieser Lust genauso erliegen. So wird die Lust an der eigenen Persönlichkeit
zum Ideal des Innenlebens wie auch zum Paradigma für die ganze Gesellschaft.
Hätten wir auf nichts Lust, wüssten wir nicht, wozu wir da sind (vgl.
Schulze 1999, S. 85-88). Die kulturellen Zeichen und die ästhetischen
Erlebnisse unserer Zeit benötigen keinen ideellen oder gar politischen
Mehrwert; Spaß macht Spaß macht Spaß macht Spaß.
Die
Konsum- und Zeichensphäre ist zum ausgezeichneten Schauplatz der Identitätsbildung
geworden. Dagegen scheint die Investition in irgendwelche Anstrengungen oder
Verantwortungen, die nicht unmittelbar an die eigene Lust und an die Persönlichkeitserweiterung
gekoppelt sind, eine Fehlinvestition zu sein. Investiert wird nur noch in das
ideelle Privateigentum, was eigentlich eine logische Fortsetzung des
Investierens in den materiellen Haus- und Besitzstand ist. So ist die Frage,
die man ständig sich selbst und an die anderen stellt: „Wie kann ich
etwas Besonderes werden, wie kann ich meinen eigenen Stil entwickeln, wie kann
ich mich unterscheiden?“ (Terkessidis 1999, S. 1). Den kulturellen
Zeichen eingebettet in die kapitalistische Struktur der Waren kommt die Rolle
eines Fitness-Studios zu, welches seine Insassen ebenfalls einem permanenten
Vergleich und einem Ekstase-Check aussetzt. Man hält sich sorgfältig und mühsam
an das Rezept der Muskel- bzw. Identitätserweiterung, und doch, welche
Verbesserung auch folgt, sie bleibt notwendig hinter dem Versprochenen und den
Idealen zurück. Und wenn es gar keine Steigerung mehr gibt, folgt die tiefe
Depression, weil es nichts mehr gibt, wovon noch geträumt werden könnte.
Hierin
schließt sich wieder der Kreis zwischen der kapitalistischen Produktions- und
Fortschrittsmaximierung als einem autarken ideellen System und der
Selbstverwirklichungspolitik der Menschen. Beide bemühen sich, ihren Erfolg
bzw. die Stimulation ihrer ästhetischen Empfindungen dadurch zu optimieren,
indem sie dem Prinzip der Nutzenmaximierung und Steigerung folgen, womit sie
indirekt versuchen, den Anschein einer Krise bzw. einer Depression zu verdrängen.
Und in ihrem Wahn zwischen Selbstversprechungen und Ekstasen münden sie
ebenda, wo sie eigentlich nie hinwollten: in der Krise oder in der Depression.
Der
Kapitalismus materialisiert die Zeichen, - die schlechten wie auch die guten,
das weiß er selbst oft nicht so genau -, denn dort stecken die Superstarträume
und die Geschichten aus dem Leben. Die Warenwelt organisiert die Differenz und
träumt doch vom Konsumenten, der allen gleich ist. Sie arrangiert ein
dissidentes Feld an Interessantem, an Subversivem, an Abweichlertum und ist
dennoch auf die Homogenität und die Stabilität des Systems angewiesen. Damit
gleicht der Kapitalismus der Politik, die trotz aller Umformung und Innovation
doch nur restaurativ wirken will, da mit den politischen Strukturen auch deren
Machthaber zusammenstecken. Denn ändert sich das System, ändern sich auch
dessen Machthaber.
Pop
formt die Superstars, Pop mit der ökonomischen Ideologie vermischt, gleicht
der Politik der Restauration: es gilt die gegenwärtigen Zustände zu
bewahren, weil dann die Machthaber an der gleichen Stelle bleiben. Den Mächtigen
kann es daher nie zu langsam mit Veränderungen gehen, und wenn es doch Veränderungen
gibt, dann sollen sie zumindest von ihnen selbst ausgehen. Die Funktion von
Pop- und Superstars ist es aber, die imaginäre Masse mit den interessanten
Vorstellungen zu beglücken und vorzutäuschen, dass es ein attraktives Modell
gibt, welches interessant ist. Eigentlich ist dieses Modell aber kein Modell,
sondern ein Faktum und eine Doktrin, weil es von denen lanciert wird, die das
System genau so beibehalten wollen. Superstars entsprechen daher der reaktionären,
restaurativen Wertevorstellung von den jeweiligen Machthabern, die damit ihre
eigene Position absichern und verstärken. Es scheint, dass diese Art der
Argumentation allzu salopp daherkommt. Sie entspricht jedoch genau der
allgemein an den Tag gelegten Naivität seitens der Politik, die jeweiligen
aktuellen Popstars gut zu finden, sowie seitens der Popstars, die immer auch
Fans von den jeweiligen Präsidenten sind. Westernhagen mochte Helmut Kohl,
Bill Clinton hörte Bruce Springsteen, Tony Blair feierte den Handschlag mit
Oasis, Grönemeyer liebte Lafontaine, Lafontaine mochte Maffay, Reagan sah am
liebsten seinen eigenen Film, und Britney sagt „Ooops“ wenn in
Texas die 112te Todesstrafe verhängt wird. Ihr Partner George W. meint dazu
nur: „I did it again“. Alles wird immer gut.
Je
mehr der mit Jugendlichkeit gekoppelte Konsumismus ins Zentrum der
Gesellschaft rückt, desto mehr wird die ganze Gesellschaft durch ihren Konsum
jugendlich. Alle sehnen sich heute nach jugendlichem Lebensstil, jugendlichem
Aussehen und nach der Flexibilität der Jugend. Und so wird Jugend für alle
zu einem Instrument der
permanenten Begutachtung: Sehe ich heute gut genug aus? Bin ich sportlich
genug? Bin ich schon zu alt, um meinen Partner zu wechseln? Macht die neue
Frisur mich jünger?
Der
Markt der Jugendlichen entwickelt sich für die Unternehmen in einen Markt für
alle. Vermeintlich für die Jugend gemachte Produkte (wie z.B. die A-Klasse)
werden von den Jugendlichen ignoriert; stattdessen bedienen sich die älteren
Generationen der jugendlichen Zeichen und verjüngen sich in
frischzellenspendenden Einkaufstouren. Selten zuvor war die Schönheitsindustrie
ein dermaßen mächtiger Agent in der Teenkultur, die wiederum immer stärker
als Zeichenlieferant für die Unternehmen fungiert. Nirgendwo wie in der
weiblichen Popkultur wird deutlicher, wie sich die Superstars den
industriellen Produkten angleichen, ja sie selbst zu Industrieprodukten
geworden sind.
Drehte
sich noch in den 70er Jahren die weibliche Körperpolitik um die Befreiung vom
Make-up der Hausfrau-Plüschhäschen-Figur, und in den 80er Jahren um die Rückkehr
zur natürlichen Weiblichkeit, dominieren heutige Weiblichkeitskonzepte als
klinisch reine Simulationen der individuellen Schönheitsideale. Der Mythos
der Demokratisierung des schönen Körpers,
angeblich in jederfraus Reichweite, so sie gewillt ist, ihren Körper
zu bearbeiten, koinzidiert mit dem Mythos der eigenen Selbstverwirklichung und
benötigt folglich nur noch Konsum von Schönheitsrealisierungsmitteln.
Ironischerweise mündet die Demokratisierung der Körper in einem einzigen ästhetischen
Bild: dem der Puppe Barbie; weiß, dünn, blond und so jung, frisch und
sauber wie möglich. Am erfolgreichsten doubelt die „Klone der Schöpfung“
(Gächter 2000, S. 1) Britney Spears das Plastikmodell aus der Industrie, und
indem sie je nach Situation in eine anderes Rollenmodell schlüpft, gestaltet
sich Britney genau so flexibel und anstandsgemäß um, wie sich auch Barbie je
nach Tageszeit und Art der Beschäftigung immer genau den bürgerlich braven
Idealen anpasst, aus denen sie geschaffen wurde. Gänzlich aus Plastikhaut und
Oberfläche bestehend, gibt es im Inneren des eigenen Körper nichts zu
entdecken, sondern es gilt, diesen Körper im Äußeren selbst zu entwerfen.
Hierbei gilt das neoliberale Credo der „Machbarkeit, Veränderbarkeit und
Verfügbarkeit“ (Baldauf 2000, S. 50), welches auch Guido Westerwelle
zum Fan von Britney werden läßt.
Jeder
kann über Britney verfügen; der Preis ist ungefähr der gleiche wie der für
eine Edition von Barbie. Und hinter beiden steckt ganz sicher nicht mehr, als
das was sie uns sowieso zeigen. „Britney ist Sex-Fantasie und dufter
Kumpel in einem, Pin-up und braves Mädchen, das man auch heiraten kann, später“
(Gächter 2000, S. 1). Nie wirkte ein weiblicher Star dominanter und
gleichzeitig harmloser; der Grund liegt in der Abwesenheit von jeglichem
Willen außer dem Willen, als Verkaufsgegenstand zu dienen. Der Superstar im
Pop vereint den kulturellen Mainstream mit den Kassenschlagern der
Marktwirtschaft: ein Cocktail aus DIN-3-D genormtem Sexappeal, bürgerlicher
Verklemmtheit und Cola light; hochgradig ästhetisiert und dabei ohne jeden
Charme.
|
|
Was
extrem ist, nehmen wir ins Programm, sagt das Fernsehen und präsentiert
Sendungen, die unverwechselbar und doch allen ähnlich sind.
Die
Rezeption des Spielfilms „Full Metall Jackett“ auf SAT 1.
|
Das
System Fernsehen kommuniziert mit sich selbst; es geht mehr um einen
Wettbewerb zwischen den Fernsehsendern als um eine Diskussion mit den
Zuschauern. Zum Beispiel soll der Satz „Wir haben die Nase vorn gehabt“
oder „Wir sind die einzigen, die den Originalton haben“ für die
Fernsehsender die bestmögliche Kommunikation/Ansprache an die Konsumenten
verdeutlichen. Gleichzeitig will der Zuschauer aber von solchen
Selbstzuschreibungen nichts wissen. „Die Entscheidungen, die im Fernsehen
getroffen werden, sind gewissermaßen subjektlos“ und von daher trifft für
das Fernsehen die Bezeichnung als „geschlossenes Milieu“ (Bourdieu
1998, S. 33) zu, das sich und seine Beteiligten selbst inszeniert und
zensiert.
Nirgendwo
wie im TV wird so deutlich, dass nicht der Träger der Inhalte (hier: der
Spielfilm) zählt, sondern der Vertrieb und die Ideologie der Unternehmen, die
den Film zeigen. Da der Gesamtstaat Fernsehen inhaltlich seine Zuschauer nicht
braucht, sondern diese nur auf die Stufe von Quotenlieferanten reduziert
werden, erzeugt jede Bewegung auf dem Bildschirm tendenziell eine „heimliche
Langeweile“ (Schulze 1999, S. 97), welche die Kenntnisnahme eines Films
auf ein „Ach wie erschreckend“ reduziert. Da vor oder nach dem Film
jegliche Bezüge zu den Inhalten des Films ausgespart bleiben, können von den
Zuschauern Zusammenhänge nicht hergestellt werden. Eine Meinung kann aufgrund
des Mangels an Kontexten nicht gebildet werden; und wenn, dann ist diese
Meinung so gefestigt, wie wenn man einen Alkoholiker fragt, welchen Stoff er
am liebsten mag. Die Antwort wird lauten: Egal, Hauptsache irgendeinen. Wie es
auch in der Ökonomie der Meinungen nicht auf die Qualität einer Meinung
ankommt, sondern darauf, dass man eine Meinung hat. So stürzt man sich an
einem Fernsehabend von einem „oh, wie erschreckend“ zu einem „ih,
wie eklig“ zu einem „ach, wie leidenschaftlich“. Der
Zusammenhanglosigkeit der Gefühle entspricht die willkürliche Anordnung des
TV-Programms. Die Inhalte in den TV-Sendungen sind einer Ökonomie der
Zeichen gewichen, die in Form egal welchen Sendetyps die Gefühle der
Zuschauer kapitalisieren sollen. Alle Sendungen entsprechen der Ideologie der
Werbung, auch wenn in ihnen gar keine Werbung vorkommt. Bei aller Vielfalt der
„folkloristischen Ereignisse“ (Schulze 1999, S. 97), die das
Fernsehen in immer extremerer Weise darbietet, und die eine Indifferenz über
die Inhalte verheimlichen soll, scheint so das Angebot immer gleich.
Als
Beispiel für die Belanglosigkeit der im Fernsehen gezeigten Inhalte kann hier
der Film Full Metal Jacket, im November 2000 gezeigt auf SAT, genannt
werden. Inhaltlich bezieht sich der Film auf die totalitäre Vereinnahmung des
Individuums durch die Ideologie des herrschenden Systems, das im permanenten
Einbrennen eines imaginären Feindbilds den Krieg ästhetisiert (was durch die
Abwesenheit der tatsächlichen Brutalitäten des Krieges leicht fällt), und
so das menschliche Gehirn immer weiter aufweicht. Nur in der diktatorischen,
menschenunwürdigen Behandlung von einem der Rekruten (die für den Krieg
ausgebildet werden) durch den Vorgesetzten, wird schon in der Theorie
angedeutet, wo die Konsequenzen der kompletten Zuteilung von Macht an ein
bestimmtes Regime liegen. Sich umzubringen ist besser als die Ideologie des
Despoten umzusetzen.
In
seiner Aussage zu den Auswirkungen von totalitären Umständen bedient sich
der Film einem Milieu, in dem der Terror am offensichtlichsten erscheint.
Jedoch geht die Dimension des Films über die Kritik an Krieg und Militär
hinaus. Jegliche autoritären bis diktatorischen Situationen sind menschenunwürdig
und berauben die Unterdrückten ihrer Freiheit, am aller ersten ihrer
Gedanken- und Meinungsfreiheit. Insofern stellt der Film eine unmissverständliche
Kritik am Fernsehen her, denn dieses arbeitet mit seiner Nivellierung der
Inhalte gegen die Meinungsfreiheit. Die „Politik der demagogischen
Vereinfachung“ ist genau das Gegenteil „der demokratischen
Intention des Informierens oder einer Unterhaltung mit Bildungsanspruch“
(Bourdieu 1998b, S. 79).
Insofern
wäre es paradox, von einem Sender wie SAT 1 eine dialektische
Auseinandersetzung mit den von ihm lancierten Sendungen (die ja inzwischen als
Formate bezeichnet werden) zu verlangen. Es ist klar, dass sich ein
TV-Sender auf seine eigenen Neigungen und Perspektiven bezieht (nämlich auf
die Politik der Vereinfachung), wenn es um die Erwartungen des Publikums gehen
soll. Insofern unterscheiden sich TV-Sender nicht von den
Wirtschaftsunternehmen anderer Branchen.
Wie
ist es möglich, dass ein TV-Sender wie SAT 1, einen Film in seine
beste Sendezeit (20.15 Uhr – 22.30 Uhr) aufnimmt, wo doch die Umsetzung der
Idee des Films zur Auflösung von SAT 1 führen müsste? Der Grund dafür ist,
dass es sich bei SAT 1 um ein Unternehmen handelt, welches nach dem
kapitalistischem Prinzip funktioniert. „Die Wahrheit, dass sie (die
Massenmedien) nichts sind als Geschäft, verwenden sie als Ideologie, die den
Schund legitimieren soll, den sie vorsätzlich herstellen. Sie nennen sich
selbst Industrien, und die publizierten Einkommensziffern ihrer
Generaldirektoren schlagen den Zweifel an der gesellschaftlichen Notwendigkeit
der Fertigprodukte nieder“ (Adorno/Horkheimer 1944, S. 129).
Jeder
(auch der Zuschauer) weiß, dass es sich bei den privaten Fernsehanstalten
nicht um Bildungstransporteure, sondern um Geldumsetzer handelt. Daher scheint
klar, dass alle Inhalte gezeigt werden können, denn alles wird auf die
Quotenbringerrolle reduziert. Die Ideologie von Full Metal Jacket auf SAT
1 entspricht also der Ideologie von SAT 1. Dies wird umso
deutlicher, wenn man die Werbeunterbrechungen des Films beobachtet: Werbung für
Erdbeermarmelade, für Schokolade, für Margarine. Na und?, kann man
sagen, ist doch überall so. Genau, es ist überall und immer so; das
Fernsehen kümmert sich nicht um die Inhalte, jedes Format kann als Lückenfüller
zwischen der Werbung dienen. Und wenn Handgranaten erlaubt wären, und
Handgranatenwerbung auch, dann liefe in den Werbepausen von Full Metal
Jacket ohne Probleme Werbung für Handgranaten. So kann das Fernsehen
alles zeigen, denn alles ist, wenn es im Fernsehen gezeigt wird, gleich. Jedem
Zuschauer ist daher klar, dass er sich beim Fernsehen nicht bilden soll; der
kritische Zuschauer ist nicht erwünscht. Wie sollte man Kritik an etwas üben,
was (angeblich) die (imaginäre) Masse verlangt? Und schließlich sind die
TV-Sender als Unternehmen auf die Zustimmung der Massen (die Quoten)
angewiesen.
Beim
Fernsehen wird offensichtlich, was auch in den anderen Bereichen der Ökonomie
die Grundlage für Geschäftserfolg bildet: die Kooperation zwischen
Zuschauer/Konsument und TV-Sender/Unternehmen. Der Konsument legitimiert die
Handlungen der Unternehmen, indem er Verständnis dafür hat, dass es darum
geht, Geld zu verdienen. Was dann letzten Endes konsumiert wird, ist zwar
nicht wichtig; dennoch scheint es angenehmer, sich in einem Bad
augenscheinlicher Differenz zu suhlen, als sich einzugestehen, dass jeglicher
Konsum mit den Verhältnissen einverstanden ist, und daher die Dauerekstase
mit Langeweile koinzidiert. Konsumenten kooperieren mit sich selbst: Da sie
immer d’accord mit sich sein wollen, sind sie angewiesen auf Differenz.
Damit sie weiter mit sich einverstanden bleiben. Am deutlichsten zeigt sich
das „Heilprogramm der Überwachung“ im Internet: jeder kann so
autonom sein und sich selbst sein eigenes Unterhaltungsmenü zusammenstellen,
egal zu welcher Zeit und in welcher Form. „Wo Dunkelheit war, ist nun
Licht; der Übergang in neue Abhängigkeit fühlt sich an wie Befreiung, wie
ein „Herauskommen““ (Baumann 1997, S. 185).
1.
Signs, trends & junk-bonds
|
|
„Es
gibt Themen genug in deinem eigenen Leben, und wenn sie einmal ausgehen,
gibt es Themenläden.“
(Die
Sterne: Themenläden, auf: Posen (CD) 1996) |
In
seinem phantasievollen Akt erschafft der Künstler oder der Werbetexter
Botschaften, bei denen er sich von einer imaginären Gruppe oder Szene ein größtmögliches
Maß an Verständnis und Anschlussfähigkeit erwartet. Ob die jeweiligen zunächst
leeren Aussagen in der Dekodierung durch die verschiedenen sozialen Instanzen
(Individuen, Szenen, Konkurrenten) tatsächlich zu Botschaften werden, hängt
von der Fähigkeit des Kreativen ab, die Bedeutung der Zeichen zu
kennen.
Somit
sind Trends nur Trends, wenn sie in der Gemeinschaft, in der sich das
Individuum als Zeichenproduzent und -konsument integriert sieht, als Trends
erkannt werden. Ist dies nicht der Fall, befindet man sich entweder in der
falschen Community oder man kann sich die Zugehörigkeiten nicht leisten. Je
nach der Brutalität der Gemeinschaft als Differenzkonsummaschine läuft man
dann allerdings Gefahr von den anderen ausgeschlossen zu werden. „Das
paradoxe Dogma des Millenniums lautet daher: Je individueller man wird, oder
richtiger: Je mehr Mittel man hat, individuell zu werden, desto mehr gehört
man auch dazu“ (Terkessidis 1999, S. 1).
Entsprechen
Trends nun einem gelungenen Zeichenpotpourri aus verschiedenen Aspekten der
Teilsysteme, wie Ökonomie, Technologie, Kultur, etc.? Kommt bei also letzten
Endes in Form der Trends zusammen, was zusammengehört? Oder
entspringen Trends einem Zufall, der dann einem Akt von Fatalismus als
Schicksal gedeutet wird? Kommt es darauf an, in einer bestimmten Situation,
Dinge aus unterschiedlichen Bereichen in einen Pseudokontext zu bringen?
Fest
steht, dass Trends durch ihre vorbestimmte Haltbarkeitsdauer fatalistischen
Tendenzen unterlegen sind. Ein Trend wäre kein Trend, wenn es nicht die
Gewissheit gäbe, dass es - kurz oder lang – zu einem Gegentrend kommt bzw.
ein derzeitig gültiger Trend irgendwann einmal langweilig wird, und auf dem Wühltisch
des Kaufhof landet, wo er als Abfall für den Rest angeboten wird. Ein
Trend wäre kein Trend, wenn er nicht Gegner hervorrufen würde, die sich
gegen den Trend wehren.
Das
Ziel von Produkten, Styles und ästhetischen Entwicklungen kann von daher nur
sein, das Trendstadium zu überwinden, und im besten Fall zu Klassikern zu
werden, denen gar keine Widerstände mehr anzumerken sind. Rama und Pampers
jedenfalls können in jedem politischen System und in jeder sozialen
Gemeinschaft überleben, weswegen sie nicht zum Stein des Anstoßes werden können.
Verkauft werden sie dennoch, solange die von ihnen propagierte Homogenität
der Verhältnisse bestehen bleibt und keine realistischen Gegenentwürfe
gefordert sind.
Trends
als kontextorientierte Assoziationsphänomene transportieren also trotz ihrer
thematischen Beschränktheit als Bündelung vorhandener Erscheinungen in einen
innovativen Bedeutungskontext eine neuartige Willensäußerung, die durch ihre
bisherige Abwesenheit erst neu einzuordnen ist. Trends werden demnach
notwendigerweise als politisch und subversiv gesehen, was gemeinhin als „Anecken“
bezeichnet wird, wodurch dann aber nichts mehr wirklich „anecken“
kann, da es schon kategorisiert wurde. Dies bringt wiederum die Gruppen und
Individuen, die wirklich „anecken“ wollen, zum Toben, sowie
die Trendgegner zum Plädieren gegen das „Aneckende“, wodurch sich
das entstandene Trendpotential erst so richtig kapitalisiert. Die
gesellschaftliche Relevanz eines Trends erkannt man schließlich daran, dass
alle behaupten, bei dem Trend handele es sich eigentlich um gar keinen Trend,
sondern um eine unspektakuläre Wiederaufnahme schon längst veralteter
kultureller Zeichen.
Thematisch
können Trends also auf keinen Fall wertlosen Phänomenen, wie
Sportereignissen, politischen Entscheidungen oder Börsenabstürzen
gleichstehen. Dennoch können aus diesen wertlosen Ereignissen relevante
Themen entstehen, die in ihrer Struktur dann den Trends übereinstimmen (vgl.
Liebl 2000d, S. 65), wenn mit ihnen Entwicklungen aus gesellschaftlichen
Tendenzen koinzidieren, wenn das Entstandene also „interessant“
scheint.
Falls
ein Trend als interessantes Thema durch einen Mangel an Beschäftigung mit ihm
nur kurzfristige Erregung hervorruft, bleibt seine Wirkung auf ein kurzes und
heftiges Dasein begrenzt, ähnlich der extremen Volatilität eines Junk-Bonds
an der Börse. Willkürlich lancierte uns somit spekulative Assoziationen können
folglich zwar für eine gewisse Zeit „in“ sein; um zu einem Trend
zu werden, fehlt ihnen jedoch die Durchschlagskraft und Verknüpfung mit
bereits Vorhandenem.
Trendanalyse
und kontextorientierte Kultursemiotik unterliegen also ähnlichen Bedingungen:
Beide beschäftigen sich mit Deutungsversuchen, die zum Ziel haben, aus
bereits vorhandenen kulturellen, gesellschaftlichen, politischen und sozialen
Hintergründen und Ressourcen in einem kreativen Akt der Verknüpfung, eine
bereits geschehene Entwicklung nachzuvollziehen, und zukünftige Tendenzen zu
erkennen. Als Frühwarnsysteme scheitern jedoch beide, wenn sie sich auf
konkrete Vorhersagen fokussieren; dazu sind Ästhetiken und Werteströme als
Eigendynamiken zu widerspenstig.
In
der Fokussierung auf bestimmte, hoffentlich in der Zukunft eintretende Formen
hat sich bisher die Trendforschung ins eigene Fleisch geschnitten: sobald ein
Trend definiert und prophezeit wird, verliert er seine mögliche Kraft, er
schwebt ohne Zusammenhang herum, weil er neu aufkommende Zusammenhänge
ignoriert. In den ökonomischen Zusammenhang gestellt, beweisen sich Trends
als Mittel zur Selbstzuschreibung der Marktwirtschaft als ein System, dem alle
anderen Bereiche untergeordnet sind, wodurch eine kontextorientierte und
objektive Analyse erschwert wird.
Insbesondere
der gleichberechtigten Einbeziehung der Kultur als offenes und diskursives
Feld kommt hier die avantgardistische Funktion des freien Gedankenspiels zu.
Verweigert sich die Ökonomie dieser Erkenntnis, und halten die Ökonomen „Kultur
für intellektuelles Filigran ohne wissenschaftlichen Wert“, „oder
für etwas, dass seiner anders gelagerten Wertigkeit wegen nichts mit Ökonomie
zu tun hat“ (Priddat 2000, S. 194), kapselt sich die Ökonomie selbst
als geschlossene Disziplin ab, was eine Auseinandersetzung mit den anderen
sozialen Bereichen unmöglich macht.
Die
allgemeine Vorstellung, bei Kunst und Kapitalismus handele es sich um zwei
gegensätzliche und grundsätzlich sich bekämpfende Bereiche, wird durch die
derzeitigen Entwicklungen, vor allem der Welt des Jugendkonsums und der Marken
widerlegt. Ganz im Gegenteil beweisen sich dabei die Skills, die
ideologische Sphäre der Zeichen
und Styles möglichst gut zu beherrschen, als Voraussetzung für bewussten und
orientierten Konsum. Der Kapitalismus dient dabei als Spielwiese und als Bazar
der Optionen, die aber erst durch die Umformierung durch die Konsumenten
mittels der von ihnen adaptierten Kunstformen zu einer gewissen Berühmtheit
und im ökonomisch optimalen Falle auf die Stufe der Legendenhaftigkeit
gelangen, auf denen sich die Marken, - wie ehedem z.B. Adidas, Red
Bull, Caterpillar oder heute z.B. FUBU oder Burton
(vgl. Maher 2000, S. 16-22) - für eine mehr oder weniger endliche Zeit auf
der Sonnenseite präsentieren dürfen.
Dabei
dient die Warenhaftigkeit des Kapitalismus ihm als eine solide Basis, durch
welche die Reflektion über die Zeichen erst einen Wert erhält, vergleichbar
einem Rhythmus- und Soundteppich, der – maschinell und aus dem Drumcomputer
erzeugt -, erst die notwendige Grundlage für die kreativen Anstürme des DJ
liefert. Ideell gesehen bleibt dem Kapitalismus zunächst nur die leidige
Rolle des Handwerkers und des Lieferanten, der zwar die Infrastruktur schafft
und die materiellen Artikel des Lebens bereitstellt,
der aber nie ein Stück von dem ideellen Ruhm erhält.
Der
ideelle Erfolg ist nur für die Virtuosen der Zeichendekodierung bestimmt,
also für die trendbewussten Konsumenten, die aber in ihrem Fandasein
gleichzeitig die Verehrung für die applizierten Marken darstellen. Letzten
Endes stellt sich auch ein ideeller Erfolg für die Marke selbst her, die es
mit ihrem Produkt geschafft hat, den geheimen Vorstellungen der Konsumenten
entgegenzukommen, und mittels einer hoffentlich nicht zu scharfen Prise
Pfeffer sogar noch heißer zu machen, als es der Markt eigentlich erlaubt. „Im
Idealfall sollte eine Ware die verschiedensten Erwartungshaltungen auf eine
Image hin vereinigen“ (Gurk 1996, S. 28). Dann entsprechen die
erfolgreichen Marken der ökonomischen Funktion von Superstars.
Dass die
Marken sich inzwischen selbst auf die Produktion von Zeichen anstelle der
Herstellung von Produkten verlagert haben, wäre zu kurz gedacht. Zwar haben
sich inzwischen v.a. in der sogenannten New Economy Marken etabliert,
die ihren Profit aus einer immateriellen Wertschöpfungskette beziehen (Lycos,
Yahoo, etc.). Dennoch bleibt im Endeffekt der Erfolg dieser ideellen
Produkte mit dem materiellen Erfolg - etwa der Werbepartner – verhaftet.
Stellt sich heraus, dass diese mit Internetwerbung keinen Mehrabsatz
verzeichnen, sind ideelle Investitionen die ersten, die gekürzt werden. Ob
dies nun ökonomisch richtig oder falsch ist, sei dahingestellt.
In
Wahrheit liegt der Erfolg von Marken in der westlichen Konsumwelt darin, zunächst
die Waren zur Verfügung zu stellen und als quasi virtuellen Beipackzettel
eine möglichst schillernde Extraganz an Dekodierungsoptionen beizufügen. So
liegt die Tatsache, dass „Nike längst keine Sportschuhe mehr, Coca
Cola kein Erfrischungsgetränk, Sony oder Ariola keine Musik-CDs und Gucci,
H&M und Boss keine Oberbekleidung“ (Zielcke 2000) verkauft nicht an
dem Einfallsreichtum despotischer Konzerne, die ihre symbolhaften
Vorstellungen von ihren Marken an hörige Kunden veräußern.
Ganz im
Gegenteil profitieren die Konzerne von dem Erfindungsreichtum der Konsumenten,
so dass die mit den Marken in Verbindung gebrachten „Zugehörigkeitsgefühle
und Lebensstile, sinnliche Attraktivität, expressive Zeichensprachen und
Anschlüsse an die Jetztzeit“ (ebd.) erst von dem dafür in Frage
kommenden Absatzpotential (Menschen, Stämme, Generationen) in einem Akt der
Kreativität und der Kommunikation erschaffen werden.
Und wenn
bei den Marken und Produkten oft deren vermeintliche Inauthentizität und der
Schein als verwerflich genannt werden, muss man erkennen, dass es den Schein
gar nicht gibt, bevor er nicht als solcher erkannt wird. Es liegt vielleicht
an dem erhaben kreativen Gefühl des Dekodierungskünstlers, dass er den
Schein der Waren erkennt, und sie dennoch kauft, weil sie ihm erst den
Kreativschub und die Möglichkeit der Freiheit arrangiert haben. Es stellt
sich also nicht die Frage nach „real“ und „fake“, „sondern es
geht um die enorme Fähigkeit, die Unterschiede zwischen „gut gemacht“ und
„schlecht“ herauszufinden“ (Wippermann 2000, S. 15). „Gerade
unter Komplizen kann kultureller Schein echte Wirkung entfalten“ (Zielcke
2000).
|
|
„Lässt
sich eine klare Unterscheidung treffen zwischen Populärkultur (subversiv,
kritisch, marginal) und Konsumkultur (dominant, affirmativ,
zentralistisch)?
(Mayer
1996, S. 157)
|
In
ihrer Vision der Zukunft sowie der Reflektion über die Vergangenheit liegt der
Gegenwartsrealismus der Kultur. Darin liegt auch der Grund der Flexibilität
ihrer Standpunkte. Indem sie den Fakten aus dem Weg geht und feststehende
Kategorien aus der Geschichte und der Zukunft hinterfragt, legt die Kultur
Gestaltungsmöglichkeiten für das Jetzt dar. Da die Kulturschaffenden aus der
Integration einer differenzierten Gesellschaft heraus arbeiten, setzen sie sich
ständig einem Feuerwerk zwischen Dissidenz und Zusammenschluss aus. Kultur
entspricht der Logik eines freien Meinungsäußerungsmarktes, solange für sie
die Voraussetzung der thematischen Richtungslosigkeit gilt.
Was
den Bereich der Zeichen und Symboliken angeht, wäre die Marktwirtschaft gerne
ebenso interessant und konsequent wie die Kultur. Sie steht aber vor dem
Problem, dass die Warenwelt der Vielfalt der kulturellen Zeichen nicht
nachkommt, und sie dadurch im kulturellen Spannungsfeld eher die Rolle des
Partymuffels spielt, der zwar die Party sponsert, aber dennoch nicht tanzen
kann. So versuchen nicht wenige, das ökonomische Feld aufzupeppen, indem sie
das Business zum „Funky Business“ (Ridderstråle/Nordström 2000, Titel) deklarieren, das Paradigma der
kapitalistischen Waren- und Monetenwelt vollständig verwerfen, und zwecks
Mehrwert zur Welt der coolen Zeichen und Avantgarden wechseln. In die New
Economy umgesetzt, mündet der kulturelle Kapitalismus in flachen
Hierarchien, den Chef duzen dürfen, flexiblen Arbeits- und Freizeiten sowie
Tanzen auf After-Work Parties. Kultur bedeutet in diesem Sinne die Befolgung von
szenerelevanten Vorgaben, wodurch sich die neue kulturelle Ökonomie nicht von
anderen Megaszenen unterscheidet. Alle Anstrengungen werden auf die
Fetischisierung bestimmter Objekte und die an diesen Objekten abgeriebene
Selbstinszenierung gerichtet. Auf dieser Ebene haben sich kultureller
Kapitalismus und kapitalistische Kultur liiert. Und indem dieses System als
geschlossenes System funktioniert, ist es unfähig, das Außerhalb des Systems
objektiv zu betrachten und zu reflektieren.
Hier
kommt dann wieder die Kultur abseits kapitalistischer Intentionen ins Spiel, die
nichts dafür kann, dass bestimmte Streams und Trends in ihr
erkannt werden, und sogleich als Spektakel für die kapitalistische Waren- und
Kulturwelt fungieren dürfen. Während die Kultur erneut einen Kontext aus dem
Kontext herausfindet, saugt sich die Ökonomie daraus wieder einen Trend aus den
Fingern. Für die Kultur kann es also letztlich nicht darum gehen, die
Vermarktung zu leugnen oder ihr auszuweichen, sondern es muss darum gehen, ob
und wie diese Vermarktung selbst zum Thema gemacht wird!
Ich
als Individuum weiß, dass die kapitalistischen Zeichen lügen, trotzdem umgebe
ich mich mit ihnen. Weil ich weiß, dass die anderen Individuen um mich herum um
die Bedeutung der Zeichen wissen. Für den Umstand, dass die Zeichen nicht
authentisch sind, dafür kann ich Individuum nichts. Also: Nur mein Wille zählt;
dann trage ich Individuum eben den Willen hervor, theoretisch ein Zeichen setzen
zu wollen und schon wird das theoretische Zeichen tatsächlich zum Zeichen. Die
Botschaft einer Sache ist genauso echt und falsch wie die Sache selbst. Dann ist
es gleich ob die Jacke aus Plastik oder Leder, ob das Hemd von Lacoste richtig
oder von Lacoste falsch ist. Hauptsache, der Wille zum Zeichen ist erkennbar, für
mich und für die anderen.
Wenn
sich die Gesellschaft zu vielen spezifischen Gesellschaften entwickelt, und die
immer differenzierteren Mikrogesellschaften sich in dem individuellen
Selbstbestimmer auflösen, welcher Moral und welcher Ethik können dann noch
alle zustimmen, welches sind die verbindlichen Grundsätze, die unveränderbar
sind? Gibt es eine Solidarität als gesellschaftliche Ordnung jenseits des
Staats im Staat in der ersten Person (Jochen Distelmeyer, in: Blumfeld:
Ich-Maschine (CD), 1992)?
Angesichts
der performativen Ausrichtung dieser Arbeit greift meines Erachtens die
Strategie, Kultur und Marktwirtschaft in einen explizit
politisch-gesellschaftlichen Diskurs einzubinden, entschieden zu kurz. Zum einen
wird den symbolisch-kulturellen Spannungsfeldern die Aufgabe zugeschoben,
Wertestrukturen zu etablieren, die die Gesellschaft selbst nicht länger zu
diskutieren vermag, zum anderen muss diese Deutung darin enden, dass
Unternehmen, Kulturschaffende und Zeichendesigner nur noch unter dem
Gesichtspunkt ihrer politischen Korrektheit und Aussagekraft betrachtet werden.
Allerdings sind weder der Kapitalismus noch die Kultur für die aktuellen
gesellschaftlichen Missstände und krisenhaften Erscheinungen verantwortlich.
Die kulturellen Zeichen bringen die Eskalationen nur zur Sprache; sie verleihen
der Krise Ausdruck.
zum
Seitenanfang
zurück